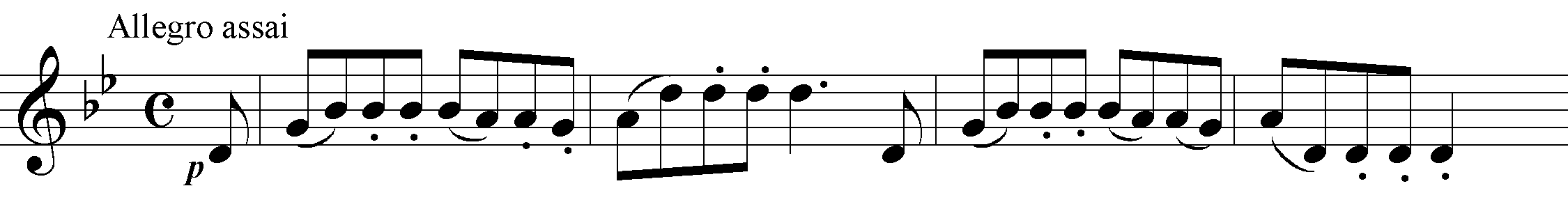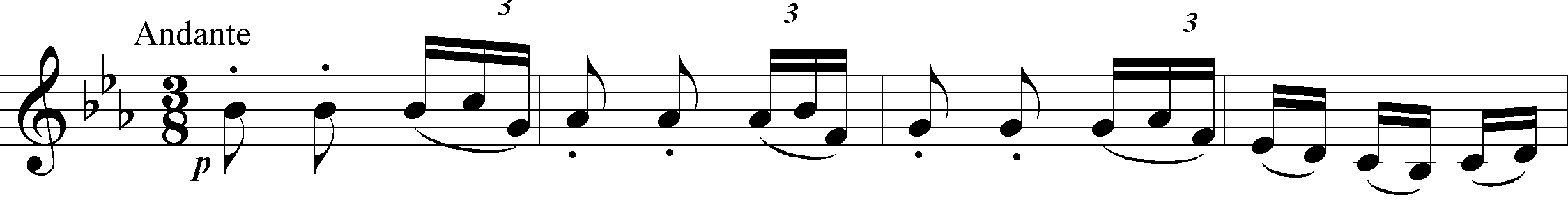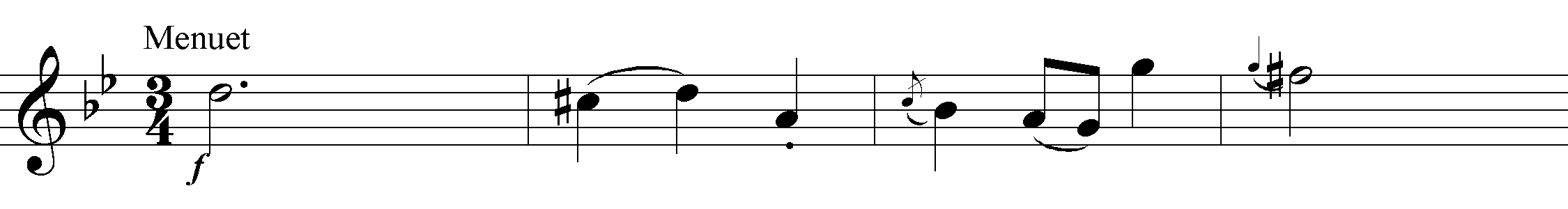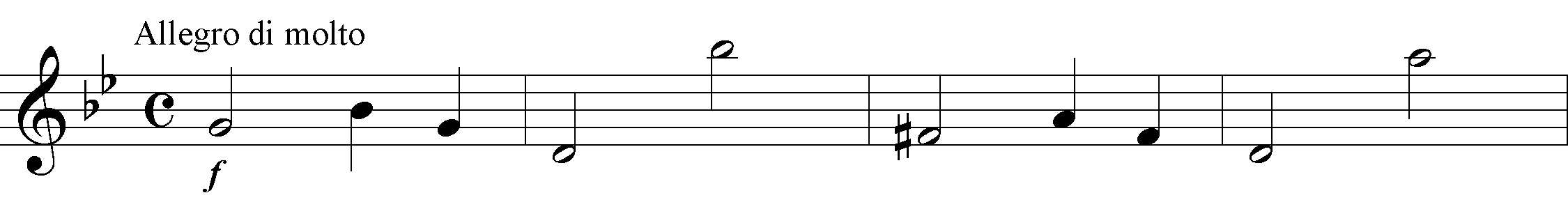39
g-Moll
Sinfonien um 1761-1765
Herausgeber: Ullrich Scheideler; Reihe I, Band 2; 2012, G. Henle Verlag München
Hob.I:39 Symphonie in F-Dur in g-Moll
Diese Symphonie nimmt in zweierlei Hinsicht eine Sonderstellung ein: Wenn das revidierte Entstehungsdatum 1765/66 stimmt, ist sie Haydns erste echte Mollsymphonie (bei der ein wenig älteren Nr. 34 steht nur der einleitende langsame Satz in Moll). Außerdem ist sie die einzige mit vier Hörnern besetzte Haydn-Symphonie, die nicht in D-Dur steht. Dabei scheint sie eine ganze Serie stürmischer Symphonien in g-Moll hervorgerufen zu haben, darunter zwei von J.B. Vanhal, eine von J.C. Bach (op. 6, Nr. 6) und eine von Mozart (die "kleine" g-Moll-Symphonie KV 183); eine der Vanhal-Symphonien und die von Mozart verwenden ebenfalls vier Hörner. Die Hörner sind paarweise gestimmt, zwei auf G und zwei auf B; dies erlaubt ihren fast unbeschränkten Einsatz auf der g-Moll-Tonleiter, sowie bei Passagen in der Paralleltonart. Seltsamerweise spielen die zwei Paare, im Gegensatz zu Haydns D-Dur-Symphonien mit vier Hörnern, jedoch praktisch nie in vierstimmiger Harmonie zusammen; selbst die solistischen B-Hörner im Trio sind (nach Haydnschem Maßstab) Routine. Daher unterscheidet sich ihr Effekt kaum von dem, der mit zwei im Abstand einer kleinen Terz gestimmten Hörnern zu erzielen ist und den wir in den meisten späteren Mollsymphonien Haydns vorfinden.
Das Allegro assai beginnt mit einem gelassenen, vier Takte langen Thema, das pro-vokativ auf der Dominanten ausklingt, mit einer bedeutungsvollen Pause; ihm folgt eine noch provokativere Fortsetzung über sechs Takte der Violinen allein, die wiederum auf der Dominanten ausklingt, diesmal als reiner Oktavklang mit einer weiteren bedeutungsschwangeren Pause. Weder die rasante zweite Themengruppe noch die eindrucksvolle Durchführung, die um eine kunstvolle kontrapunktische Passage kreist, kann den unheimlichen Effekt dieses Auftakts abschwächen; er steht als geistiges Motto über dem gesamten Satz (und führt zu den erwarteten "Überraschungen" in Rückführung und Reprise). Das charmante Andante im 3/8-Takt steht in der ungewöhnlichen Untermediante der Grundtonart (Es-Dur); dies war Mozarts liebste Tonartrelation, während Haydn gewöhnlich die Paralleltonart oder Tonika-Durtonart wählte. Das Andante wurde zu unrecht kritisiert wegen seiner "Seichtheit" im Rahmen einer Mollsymphonie, aber das erscheint inzwischen als anachronistisch romantisch: Es gibt kein Gesetz, wonach jede Mollsymphonie von Haydn den Eindruck erwecken muss, "durchkomponiert" zu sein, wie dies bei der "Abschiedssymphonie" oder der Nr. 44 in e-Moll der Fall ist. Der Satz kann sich zahlreicher raffinierter und witziger Effekte rühmen, und einer unerwarteten Codetta am Schluss. Im Trio des Menuetts kommen Oboen und Hörner vor; der Hauptteil zeichnet sich durch die strenge Kargheit aus, die Haydns zweistimmige Kompositionsweise bestimmt, hier mit pikanten Balkanklängen (hochalterierte Quarte) gewürzt. Das Finale Allegro di molto steht dem ersten Satz insofern entgegen, als es keine Muße für Provokationen aufbringt. Es ist durchweg leidenschaftlich (man beachte die "weiten Sprünge" im Eröffnungsthema, die nach Ansicht mancher ebenfalls "Bühneneffekte" sind) und durcheilt eine knappe turbulente Sonatensatzform, die nur an der unwahrscheinlichsten Stelle abgemildert wird: in der ersten Hälfte der Durchführung.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
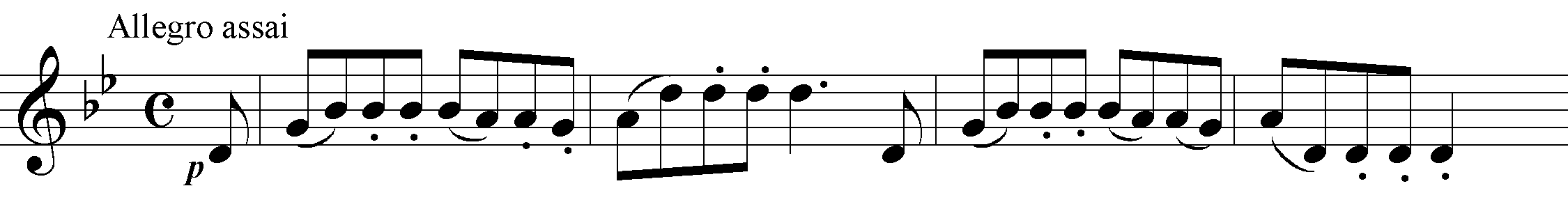
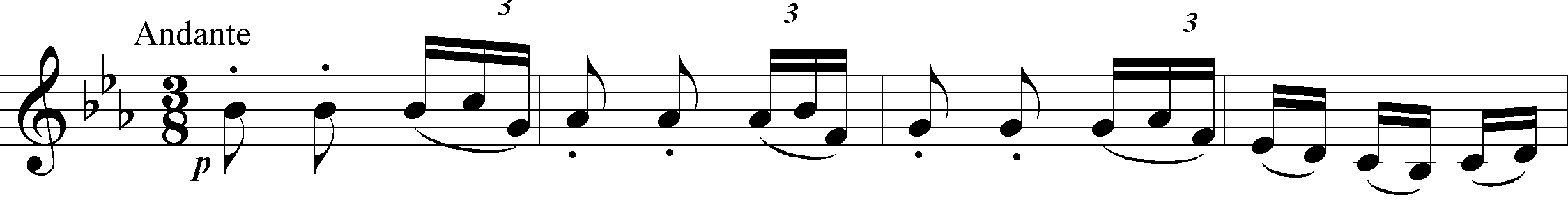
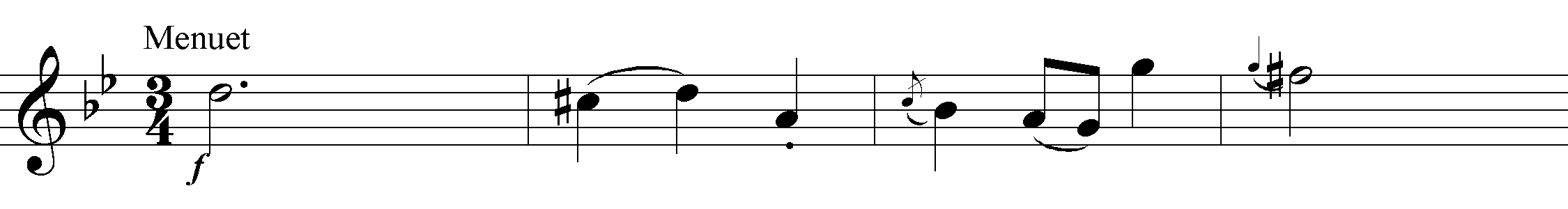
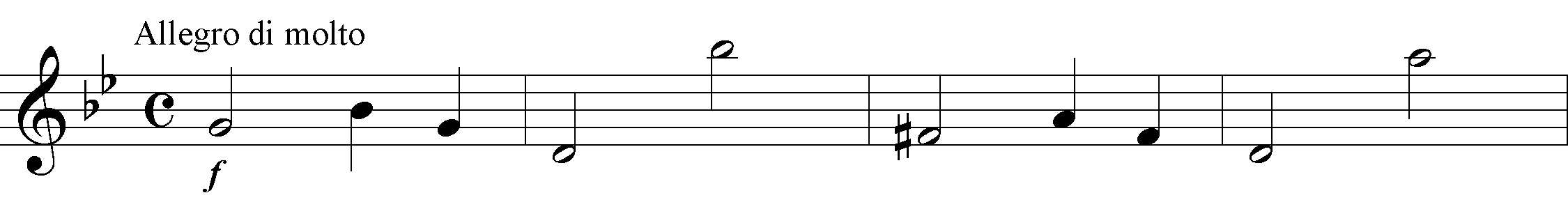
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)