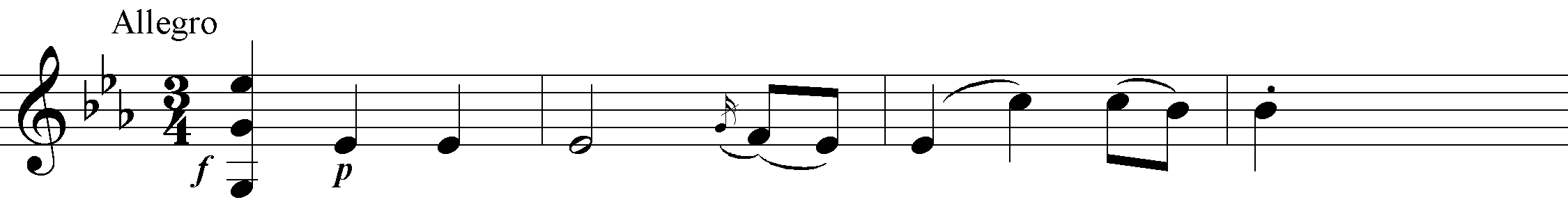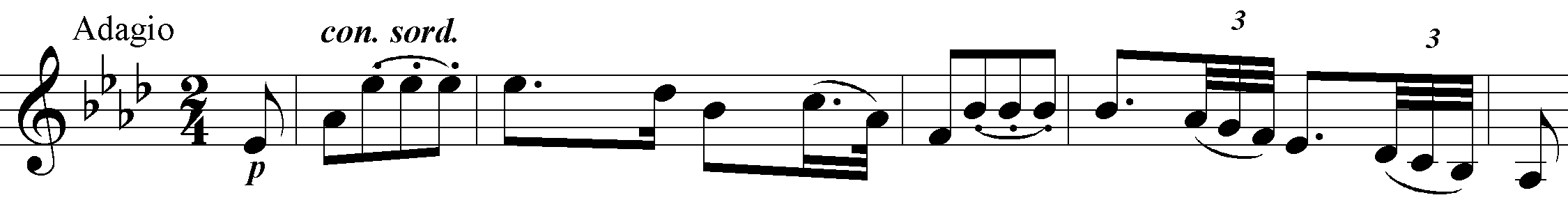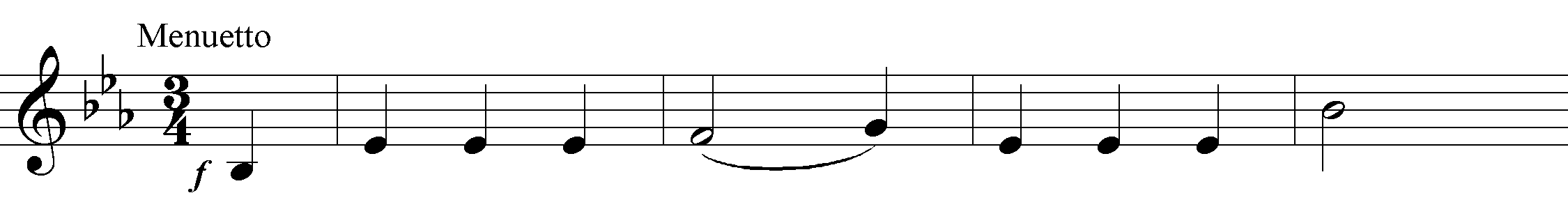43
"Merkur"
Es-Dur
Sinfonien um 1770-1774
Herausgeber: Andreas Friesenhagen und Ulrich Wilker; Reihe I, Band 5b; 2013, G. Henle Verlag München
Hob.I:43 Symphonie in Es-Dur
Das ausgedehnte Thema im ersten Satz täuschte sogar einen so guten Kritiker wie Charles Rosen, der es als "beschauliche entspannte Schönheit... auf Kosten einer energielosen Kombination zwischen kadenzierten Harmonien und einem ausgesponnenen Rhythmus" bezeichnete. (Diese Fehldeutung ist Teil seiner Verteidigung der unhaltbaren Ansicht, dass Haydn erst in den 1780er Jahren wirkliche Reife erreichte, gleichzeitig mit dem Triumph des "klassischen Stils".) Zugegeben, das Thema scheint etwas ziellos um die erste Umkehrung des Tonikadreiklangs zu kreisen, aber das ist gerade Haydns Absicht. Es schreitet zu lange fort, weigert sich zu demonstrativ, etwas zu tun, so dass wir zunehmend unruhig werden, mehr und mehr das Bedürfnis haben, etwas Neues zu hören. Haydn präsentiert es uns auch am Ende, wenn die Violinen mit einem plötzlichen forte in Tremolo-Sechzehnteln herabstürzen und der harmonische Rhythmus sich steigert. Das führt dann zu einer überaus kraftvollen Kadenz, die das erste Thema abschließt und zur energischen Überleitung führt.
Der Rest der Exposition behält den kräftigen Ton bei, außer in einer kurzen ruhigen Passage, die die "statische" Anfangssequenz wiederholt. Aber die Durchführung führt (nach der Wiederholung der Exposition) bald zu einer weiteren Wiederholung von Teilen des ersten Themas in der Tonika. Dieser Vorgang ist weder eine "falsche Reprise" (die mitten in der Durchführung auftaucht) noch ein Formfehler, sondern etwas, was ich eine "unmittelbare Reprise" nennen würde. Dies ist eine raffinierte Variante der älteren Praxis, in der die Durchführung mit einer zweifachen Vorstellung des Hauptthemas begann, zunächst auf der Dominante, dann auf der Tonika. Natürlich weicht Haydn bald in andere Tonarten aus, aber kurz darauf bricht er wieder ab, und eine dreifache Sequenz, die auf dem Eröffnungsthema fußt, führt zur eigentlichen Reprise. (Ein ähnlicher Vorgang findet sich im Streichquartett in D-Dur, op. 20 Nr. 4. Die "exzessive" Allgegenwart des Hauptthemas wird so geistreich in die Form als Ganzes eingefügt.
Das Adagio läutet noch eine weitere Änderung in der gehaltvollen Tiefe ein, die für Haydns langsame Sätze so typisch ist. Die Aufteilung in Abschnitte (erstes Thema, Überleitung, zweites Thema; Durchführung; Reprise) ist für Haydns Verhältnisse überaus klar; er nähert sich selten der "Mozartschen" Qualität an, bei der jeder Takt wie vorherbestimmt wirkt. Vielleicht hat er deswegen eine chromatische "seufzende" Passage in das zweite Thema eingefügt und sie — wiederum "zu lang" — in der ganzen zweiten Hälfte der Durchführung benutzt.
Das lebhafte Menuett ist in seinem äußeren Aufbau klar gegliedert, obwohl es subtile Variationen in der Behandlung der "langkurz" Motive aufweist. Seine ruhige Schlussphase wiederholt das "statische" Eröffnungsthema der Symphonie. Im Trio beweist uns Haydn, dass eine einzige Viertaktphrase (2+2), selbst wenn sie viermal hintereinander zu hören ist, nicht langweilig wirkt, wenn sie zunächst eine Kadenz auf der Dominante, dann eine auf der Tonika vorbereitet.
Im Allegro-Finale wird Haydns unterschwellige Exzentrik noch offensichtlicher. Das ruhige Hauptthema ist mit seinen schnellen Aufwärtssprüngen in seiner Phrasierung demonstrativ unregelmäßig. Trotz des schnellen Tempos wird die Musik "zu oft" unterbrochen; diesen Fermaten folgen manchmal ausgedehnte Auftakte in den Violinen, manchmal auch chromatische Fortschreitungen in langen Notenwerten. In der Durchführung leitet dann einer dieser ausgedehnten Auftakte sehr witzig in die Reprise über. Dieser Abschnitt ist ungewöhnlich regelmäßig und kadenzierend — eigentlich zu sehr: Nach der Wiederholung der zweiten Hälfte des Satzes folgt eine lange Coda, was recht ungewöhnlich ist. Dies ist nicht nur exzentrischer als alles bisher Dagewesene, darüber hinaus vermeidet Haydn auch systematisch jede Kadenzierung bis zum allerletzten Moment. Der unpassende Name "Merkur", der der vorliegenden Symphonie im 19. Jahrhundert gegeben wurde, entbehrt jeder Grundlage.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
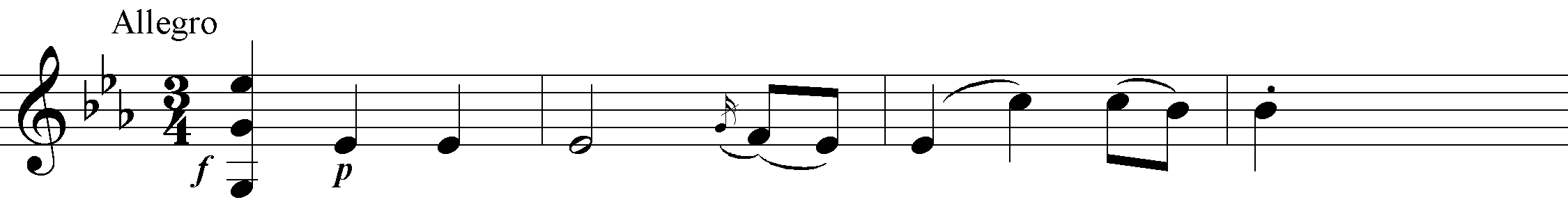
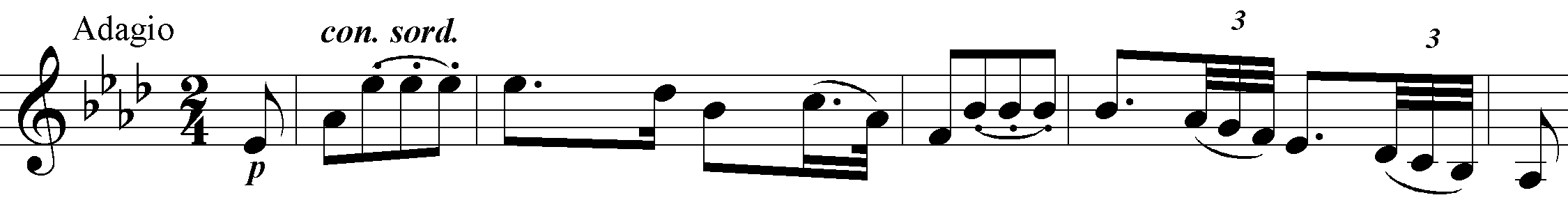
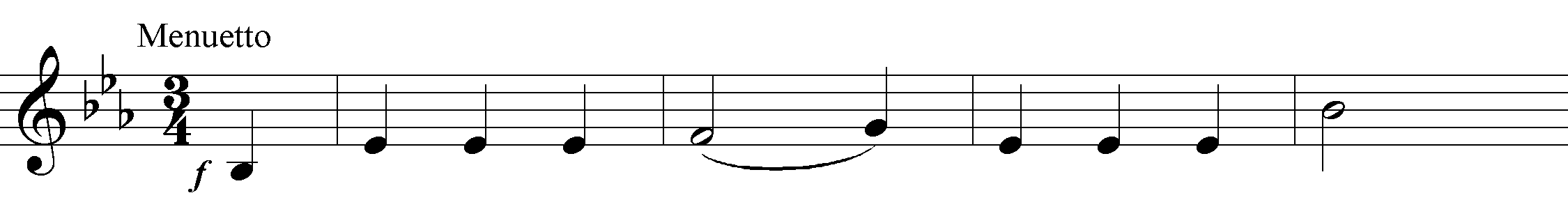

Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)