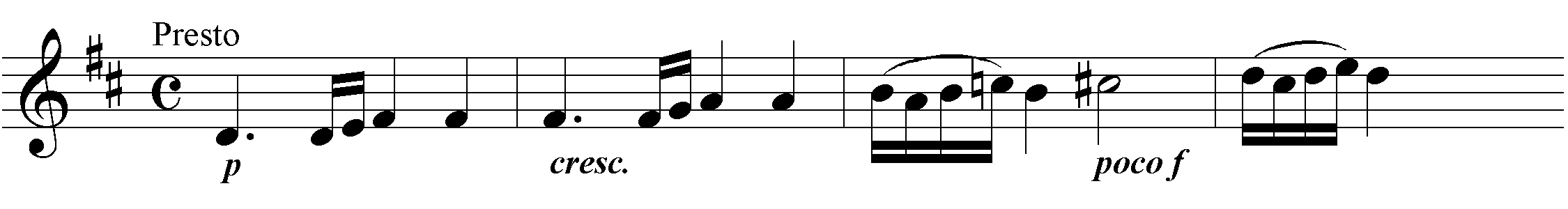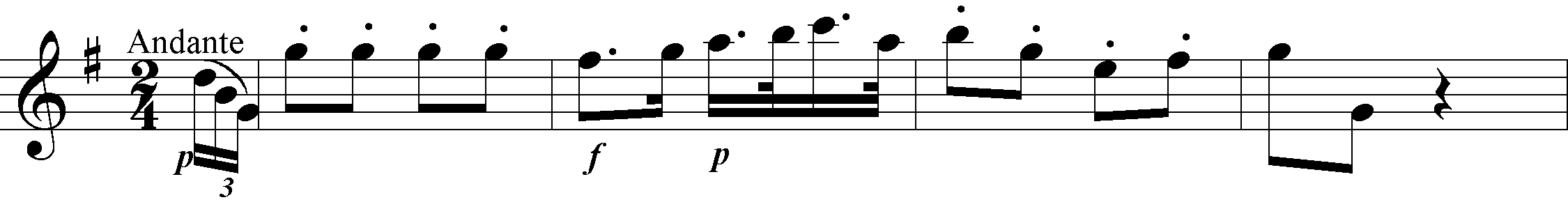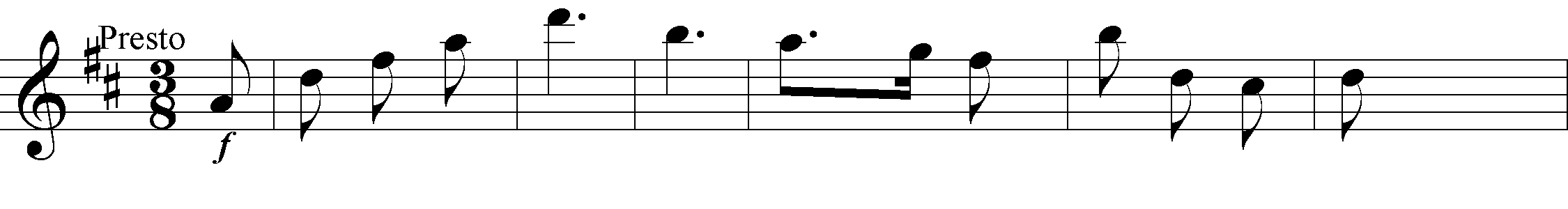1
D-Dur
Sinfonien um 1757-1760/61
Herausgeber: Sonja Gerlach und Ullrich Scheideler; Reihe I, Band 1; G. Henle Verlag München
JOSEPH HAYDN Symphonien für Graf Morzin, ca. 1757-61
Diese frühste Gruppe von Haydns Symphonien zeigt ein relativ gleichförmiges Profil, wenigstens wenn man sie mit der fast verwirrenden Vielfalt der Werke der Folgen 2 und 3 vergleicht. Wie schon aufgezeigt, sind alle elf Werke für zwei Oboen, zwei Hörner und Streicher gesetzt (Trompeten und Pauken kommen noch in der Symphonie Nr. 32 hinzu) und nur der langsame Eröffnungssatz der Symphonie Nr. 5 ist durch eine offenkundig konzertante Schreibweise gekennzeichnet. Die Werke dieser Gruppe teilen sich in genau definierte zyklische Muster, die außerdem in Wechselbeziehung zu Stil und Tonarten der einzelnen Sätze stehen; diese Verbindung von zyklischen Formen und Satzstilen schafft eine Anzahl verschiedener "Typen" für alle Symphonien. (Keine lässt sehen, was später das gültige Viersatz-Standardmodell werden sollte, schnell - langsam — Menuett - schnell.) Es waren diese klaren Formtypen, die dem Hörer des 18. Jahrhunderts weithin Verständlichkeit garantierten.
Die meisten dieser Symphonien (Nr. 1, 2, 4, 10, 27, 107 [A]) stehen in der dreisätzigen Form, schnell — langsam - schnell, mit dem langsamen Satz in einer kontrastierenden Tonart. Die einzigen viersätzigen Werke mit einem schnellen Eröffnungssatz stehen in C-Dur (Nr. 32 und 37); ihre beiden Mittelsätze ordnen sich jedoch in "umgekehrter" Reihenfolge (das Menuett folgt auf den langsamen Satz). Die beiden anderen viersätzigen Werke (Nr. 5 und Nr. 11) platzieren den langsamen Satz an den Anfang, was die Reihenfolge langsam — schnell — Menuett - schnell ergibt; zusätzlich stehen alle vier Sätze in der Tonika. Von allen anderen Kompositionen in Folge 1 unterscheiden sich die beiden Werke auch dadurch, dass sie in den relativ "entfernten" Tonarten A-Dur und Es-Dur stehen (ansonsten rangieren die Tonarten nur zwischen D-Dur und B-Dur). Auch Symphonie Nr. 18 beginnt mit einem langsamen Satz, der Zyklus wird aber nur mit zwei zusätzlichen Sätzen (alle in der Tonika) vervollständigt: einem Allegrosatz und einem Tempo di Menuet als Schlusssatz.
Die schnellen Eröffnungssätze sind immer die längsten und gewichtigsten in den betreffenden Werken, sie stehen in Sonatenform oder einer engen Variante und im 3/4 oder 4/4 Takt. (Einzige Ausnahme bilden die beiden viersätzigen Symphonien in C-Dur, bei denen das eröffnende Allegro molto im 2/4 Takt steht, der später zur typischen "Finale"Taktart wurde.) Die langsamen Sätze sind ebenfalls relativ schnell (Andante) und gewöhnlich "leicht" im Stil (selbst wenn sie in einer Molltonart oder im Pseudo-Kontrapunkt stehen) und benutzen ebenfalls die Sonatenform; sie sind ausschließlich für Streicher gesetzt. Die Finalsätze sind sehr schnell und sehr kurz, und stehen im 3/8 Takt (Nr. 107 [A] im 6/8 Takt); sie weisen entweder eine Miniatursonatenform oder Da capo-Struktur auf.
Vergleichend dazu neigt der langsame Eröffnungssatz der Symphonien Nr. 5, 11 und 18 — wie es seine führende Stellung fordert — zu einem gewichtigen, hoch entwickelten Adagio (in der Symphonie Nr. 18 ein Andante, aber trotzdem fein gearbeitet und teilweise kontrapunktisch). Er schließt die Oboen und Hörner mit ein. Folglich ist der an zweiter Stelle stehende wichtigste schnelle Satz kürzer und einheitlicher in seiner Struktur, oder formal weniger entwickelt wie der schnelle Eröffnungssatz. Als Folge davon wiederum vermeidet der Finalsatz den kurzen 3/8 Typ zugunsten des Zweiertakts, einer ausgearbeiteten Sonatenform und unterschiedlichen Stilen (oder in Nr. 18 ein langes "Tempo di Menuet").
Diese "Typen" sind in der Tat einfach zu erfassen. Was zunächst weniger offensichtlich sein mag — aber umso wichtiger — ist Haydns Meisterschaft innerhalb dieser offenbar begrenzten Vorgaben. Die herrschende Vorstellung von seinen "unreifen" Anfängen ist ein Mythos, eine trügerische Rechtfertigung der Meinung, er habe den "klassischen Stil" um 1780 erfunden. Haydn dachte anders: nach seiner eigenen Überlieferung lernte er "die ächten Fundamente der sezkunst" von Nicola Porpora (vermutlich seit 1753); wie wir gesehen haben, begann er nicht lange danach mit der Komposition von Symphonien. Tatsächlich zeigen seine frühsten Symphonien die ideenreichen, erfinderischen und vielfältigen Antworten, die einen reifen Künstler charakterisieren. Diese Werke verfugen über vollste musikalische Technik, angemessenen Stil und sind (vergisst man erst einmal den "klassischen Stil") überraschend ausdrucksstark. Viele Werke zeigen bedeutende thematische Ergänzungen und beweisen eine einzigartige und überzeugende Handhabung der sinfonischen Form. Sogar die vermeintlichen Routine Da-capo-Schlüsse hegen eine reiche Vielfalt von Verfahrensweisen; jede ist in der Form einzigartig. Je besser wir Haydns frühe Symphonien kennenlernen (und je mehr Werke wir von anderen zeitgenössischen österreichischen Komponisten hören), umso mehr werden wir von ihren technischen Kompetenzen und ihren generischen und rhetorischen Qualitäten überzeugt sein.
©James Webster
Hob.I:1 Symphonie in D-Dur
Diese bekannteste von Haydns frühsten Symphonien beginnt ungewöhnlicherweise mit einem aufsteigenden Crescendo (nicht zu verwechseln mit dem viel längeren und stabileren "Mannheimer Crescendo"). Das eröffnende Presto enthält trotz seiner nicht versiegenden rhythmischen Energie viele verschiedene motivische Ideen — es sind keine wirklichen "Themen" — und Änderungen der Struktur: zum Beispiel das plötzliche Abbrechen und das kontrastierende piano der in der Dominante stehenden zweiten Themengruppe — zu einem Zeitpunkt, wenn man gerade eine Kadenz erwartet; oder die kurze erregte Mollepisode in den kontrastierenden Anderthalbtakt-Phrasen. Die kurze Entwicklung zerlegt die Motive und kombiniert sie wieder neu. Auffallend sind die Hornsignale, die die bevorstehende Reprise ankündigen, die beträchtlich gekürzt, ansonsten aber regelmäßig abläuft. Der langsame Satz begründet sofort die unnachahmlich lebhafte Tiefsinnigkeit, die so charakteristisch für Haydns Andante-Mittelsätze ist. Er steht in Sonatenform mit einer überraschenden Mollwendung und einem dichten Kontrapunkt für die Reprise des Anfangsthemas. Das abschließende Presto belegt Haydns "knappen 3/8" Finalstil. Die Phrasierung ist jedoch unregelmäßig und durchgehend nicht voraussehbar.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
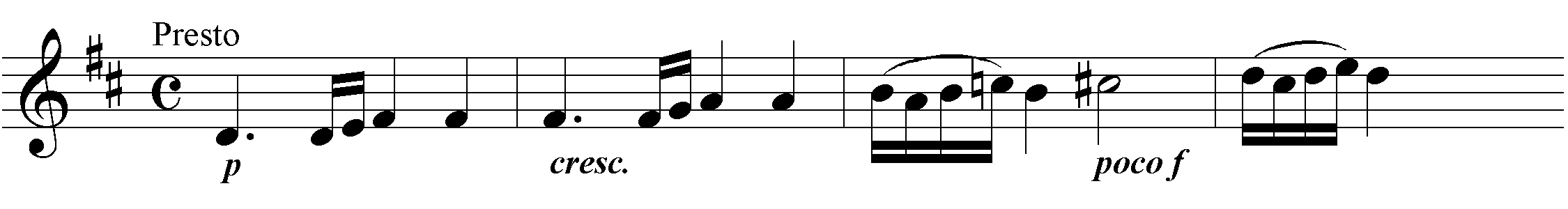
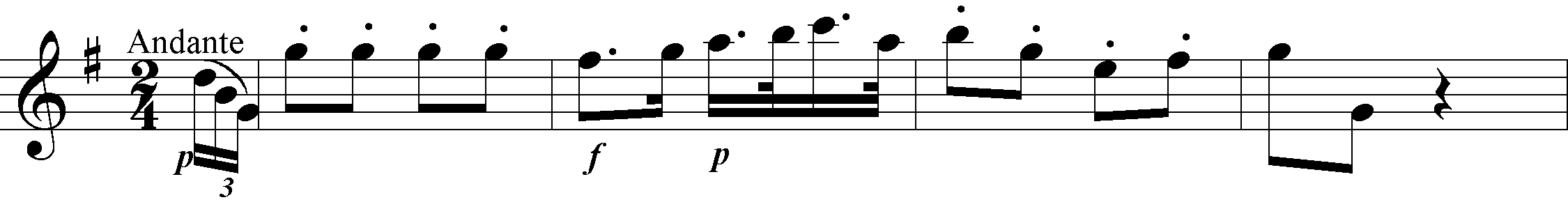
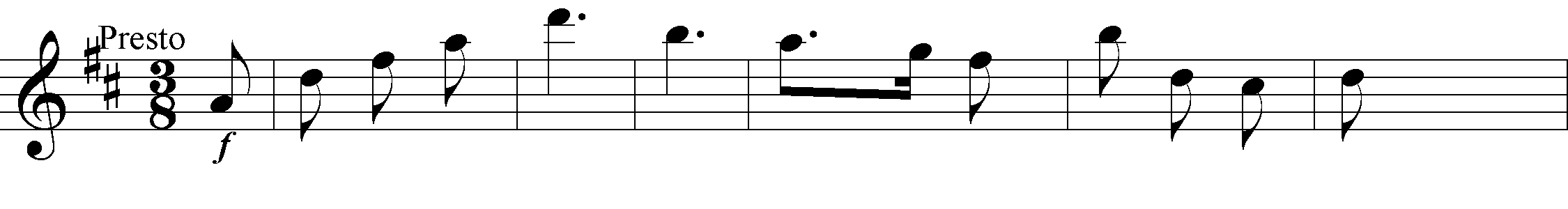
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)