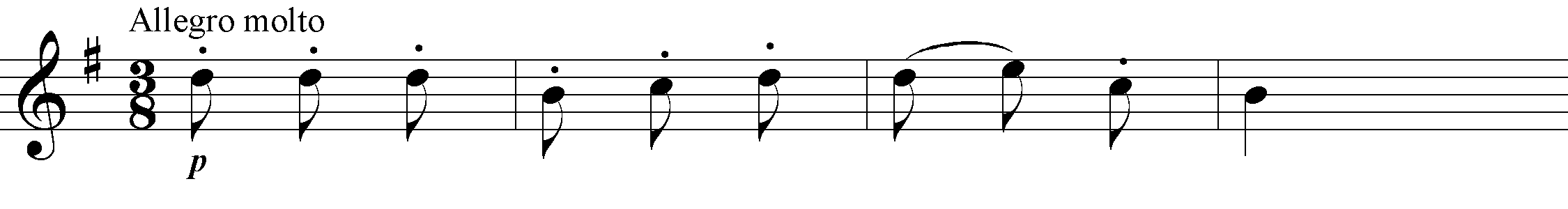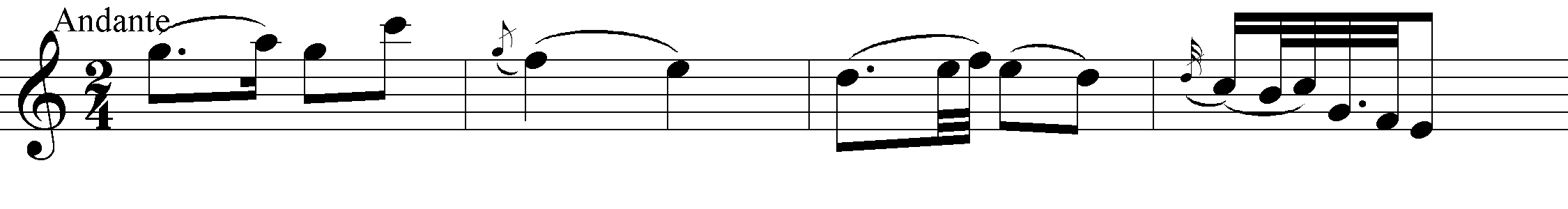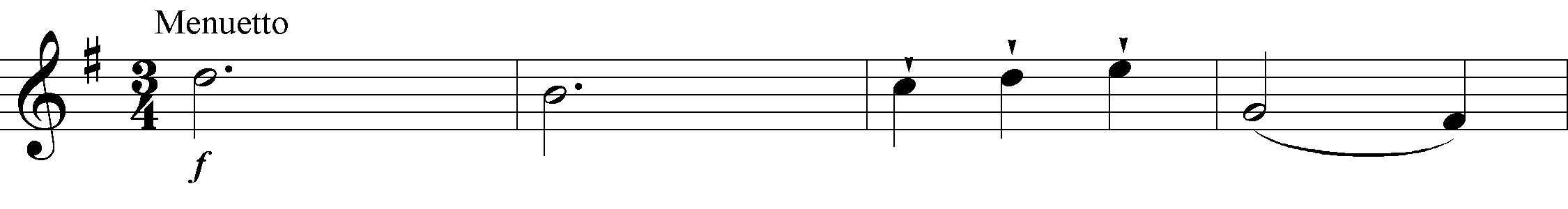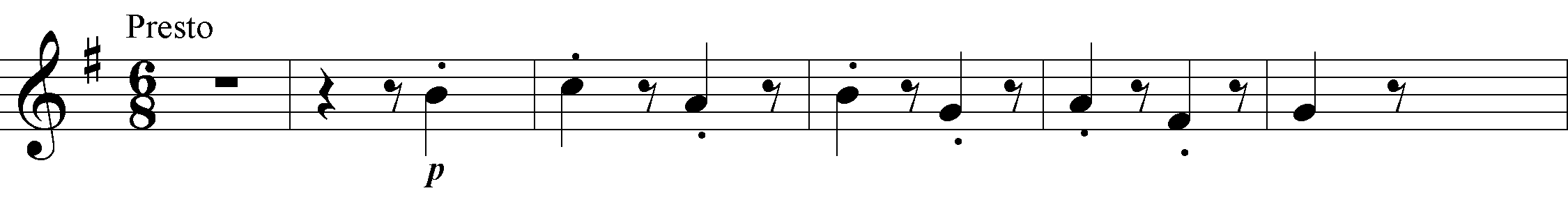8
"Le soir"
G-Dur
Sinfonien 1761-1763
Herausgeber: Sonja Gerlach und Jürgen Braun; Reihe I, Band 3; G. Henle Verlag München
Joseph Haydn: Frühe Esterházy-Symphonien, 1761-1763
Haydn, der Experimentierfreudige Weitaus stärker als zuvor zeichnen sich Haydns Symphonien der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts durch ihre abwechslungsreiche stilistische Gestaltung, Thematik und Orchestrierung aus. Was die in diesem Band vertretenen Symphonien angeht, so ist die Trilogie "Matin/Midi/Soir" (Nr. 6-8) mit ihrem gehaltvollen konzertierenden Satz, ihrem epischen Ausmaß und ihren umfangreichen außermusikalischen Assoziationen gänzlich verschieden von den kürzeren dreisätzigen Symphonien Nr. 9, 12 und 16 (die sich wiederum untereinander wesentlich stärker unterscheiden als die Nr. 6-8). Von den viersätzigen Symphonien des Jahres 1763 beschließt die Nr. 40 mit einer strengen Fuge, während in Nr. 13 und 72 vier Hörner anstelle der üblichen zwei vorkommen. Doch auch sie heben sich voneinander ab: Die Nr. 13 weist einen dichten Satz auf und endet mit einem bewusst "intellektuellen" Finale, während die Nr. 72 durchweg im konzertierenden Stil geschrieben ist.
Diese Vielfalt wurde traditionell so interpretiert, dass sich darin Haydns Freude am kompositorischen "Experimentieren" in seinem neuen Amt am Hofe Esterházy äußert:
Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zufrieden, ich erhielt Beyfall, ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt, und was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt abgesondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen, und so musste ich original werden.
Diese bekannte Aussage bezieht sich auf Haydns Bemühen um "wirkungsvolles" Komponieren — auch in Fragen der Rhythmik und Proportion, des instrumentalen Gleichgewichts und der Satztechnik — und auf das Thema Originalität in der allgemeinen Bedeutung, keinen Vorbildern zu folgen oder keiner "Schule" anzugehören. Die Musikwissenschaft hat jedoch diese stilistische Mannigfaltigkeit als Anzeichen dafür gedeutet, dass Haydn (bewusst oder unbewusst) ein "Ziel anstrebte", und somit impliziert, dass er es noch nicht "erreicht" hatte. In Bezug auf seine persönliche Entwicklung wird dieses Ziel als das Erlangen der "Reife" während seiner sogenannten "Sturm-und-Drang"-Periode (ca. 1768-72) definiert; die Musikgeschichte dagegen versteht darunter nichts Geringeres als die Schaffung des "klassischen Stils". Diese theologische Betrachtungsweise hat ambivalente, ja sogar abwertende Urteile über Haydns Musik der frühen und mittleren 6oer Jahre des 18. Jahrhunderts begünstigt.
Diese Ansichten sind unhaltbar. Wenn Haydn ein "experimenteller" Komponist war, dann ist er es zeit seines Lebens geblieben, bis hin zu den "Londoner" Symphonien, bis hin zum Chaos-Licht-Musik der Schöpfung und bis hin zu den Jagd- und Trink-Chören der Jahreszeiten. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Haydn selbst, die Fürsten Esterházy oder das Publikum seine frühen Symphonien in irgendeiner Hinsicht unbefriedigend fanden. Im Gegenteil sind wir, je besser wir seine Frühwerke kennenlernen, umso überzeugter von ihrer technischen Kompetenz und ihrer gattungsmäßigen und rhetorischen Angemessenheit. Das heißt nicht, zu leugnen, dass unter ansonsten gleichen Voraussetzungen ein späteres Werk von Haydn gehaltvoller und komplexer, ja satztechnisch dichter wäre als ein früheres. Doch war seine Musik niemals im eigentlichen Sinne "unreif — am wenigsten seine große programmatische Trilogie von 1761 oder die übrigen hier aufgenommenen Symphonien.
©James Webster
Hob.I:6, 7 und 8
"Le matin", "Le midi", "Le soir" und Haydns Symphonien mit außermusikalischem Bezug Außermusikalische Assoziationen waren in den österreichisch-böhmischen Symphonien des mittleren und späten 18. Jahrhunderts gang und gäbe. Seinen frühen Biographen Griesinger und Dies zufolge äußerte sich Haydn, dass er oft literarische und außermusikalische Sujets und Topoi seinen Symphoniesätzen zugrunde legte.
Mit Ausnahme der "AbschiedsSymphonie" und Nr. 46 in H-Dur sowie einigen anderen, die wie die Nr. 60 ("Il distratto") als Bühnenmusiken entstanden sein könnten, scheinen diese Werke nicht in dem Sinne programmatisch gewesen zu sein, dass sie auf einer bestimmten literarischen Idee oder einem Text beruhten. Vielmehr lassen sie an traditionelle oder "typische" Topoi denken, beispielsweise an Tages- und Jahreszeiten (Nr. 6-8), an religiöses Brauchtum (Nr. 26 in d-Moll, Nr. 30 in C-Dur), an ethnisch bedeutungsvolle melodische Motive und Musikstile (Nr. 63 in C-Dur, Nr. 103 "mit dem Paukenwirbel" und viele andere), an Jagd und Hörnerklang (Nr. 31 "mit dem Hornsignal" und Nr. 73 "La chasse") und an Sprichwörter (Nr. 64 "Tempora mutantur"). Diese Themen beeindrucken nicht nur durch ihre Vielfalt, sondern auch durch ihre Beschäftigung mit wesentlichen Menschheits- und Kulturfragen; sie dokumentieren Haydns moralische Ernsthaftigkeit — einen wichtigen Gesichtspunkt seiner musikalischen Ästhetik, der aufgrund unserer Vorliebe für "absolute" Musik und die Neigung, uns auf seinen Witz und Humor zu konzentrieren, gewöhnlich unterbewertet wird.
Haydns Trilogie von 1761 wurde, wie aus dem recht verworrenen Bericht seines frühen Biographen Albert Christoph Dies hervorgeht, von Fürst Anton Esterházy persönlich angeregt: Der Fürst selbst gab Haydn das Thema für die Komposition, die er in Form von Quartetten ausführte. Obwohl wir es mit drei Symphonien anstatt mit vier Quartetten zu tun haben, wird der Gehalt dieser Anekdote durch das Entstehungsdatum der Symphonien bestätigt (Fürst Anton starb im April 1762), und durch Haydns Bemühen, jedes Mitglied seines neuen Ensembles musikalisch "vorzustellen"; die meisten Dienstverträge der Musiker traten wie der von Haydn selbst am 1. Mai 1761 in Kraft. Die naheliegende, wenn auch spekulative Schlussfolgerung ist, dass dies tatsächlich die ersten Symphonien waren, die Haydn für den Esterházy-Hof komponierte; ansonsten sind keine auf das Jahr 1761 festzulegen.
Haydns Trilogie nutzt eine der ältesten und bedeutsamsten künstlerischen Traditionen des westlichen Kulturkreises: das Pastoral. Das Thema der "vier Tageszeiten" ähnelt dem der "vier Jahreszeiten"; beide beschwören natürliche Zyklen, die für die menschliche Kultur von fundamentaler Bedeutung, wenn nicht gar Metaphern des Lebens an sich sind, und sie haben die gleiche innere Struktur:
| Dämmerung/Morgen | Mittag | Nachmittag/Abend | Nacht |
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
| Aussaat | Wachstum | Reife | Verfall |
| Geburt/Jugend | Erwachsen-Sein | Reife | Alter/Tod |
Die "jahreszeitliche" Variante dieser Tradition war zu einem früheren Zeitpunkt im 18. Jahrhundert durch Vivaldis berühmte und einflussreiche Konzerte aus dem Opus 8 veranschaulicht worden, und an der Wende zum 19. Jahrhundert durch Haydns eigene Jahreszeiten. "La tempesta", die Darstellung eines Sturms im Finale von "Le soir", ist eindeutig pastoral (man vergleiche Beethovens "PastoralSymphonie"); darüber hinaus erinnert sie an den Titel "La tempesta del mare", der darüberhinaus in zwei weiteren Vivaldi-Konzerten Verwendung gefunden hat. Partituren all dieser Werke von Vivaldi befanden sich im Besitz des Esterházy-Hofes. Auch die tageszeitliche Sequenz ist weit verbreitet. Eine Serie von vier Balletten, Le matin, Le midi, Le soir und La nuit, wurde 1755 in Wien herausgebracht, als Haydn dort lebte und arbeitete; auch diese Partituren besaß der Hof von Eszterháza. (Das Konzept der zeitlichen Abfolge im Laufe eines Tages findet sich außerdem in Beethovens "Pastorale".) Ein greifbarerer Einfluß ging von Gluck aus: Das einleitende Thema von Haydns "Le soir" zitiert eine populäre Melodie aus einer Opéra comique des älteren Meisters mit dem Titel Le diable à quatre, die im April 1761 in Wien wiederaufgenommen wurde — einen Monat vor Haydns Amtsantritt am Hofe Esterházy. Zweifellos lebte Haydn damals wieder in Wien und hätte sich die Inszenierung durchaus ansehen können; noch wahrscheinlicher ist, dass Fürst Anton sie besuchte.
Zahlreiche Details von Haydns Trilogie betreffen sowohl traditionelle Gepflogenheiten der Pastoralmusik, als auch programmatische Elemente, die in seiner eigenen späteren Musik zu finden sind. Nr. 6 und 7 beginnen mit langsamen Einleitungen, die bis zu den 80er Jahren in Haydns Musik sehr selten vorkommen. Die Einleitung von "Le matin" legt natürlich einen Sonnenaufgang nahe; diese Assoziation wird bekräftigt durch die musikalisch ähnlichen Sonnenaufgänge in der Schöpfung und den Jahreszeiten. Im Gegensatz dazu ist die von "Le midi" eine majestätische Beschwörung, die dem "elysischen" langsamen Satz (siehe unten) verwandt sein könnte.
Die auffallende Rolle der Flöte in allen drei Symphonien bezeichnet das Pastorale direkt: Man beachte die Hauptthemen beider Ecksätze von "Le matin", die paarigen Flöten im langsamen Satz von "Le midi" sowie "La tempesta". Die im letztgenannten Satz vorkommenden Blitzschläge — schroffe, abwärts gerichtete Flötenarpeggien - treten fast identisch in den Jahreszeiten wieder auf, zu Beginn des sommerlichen Gewitters. 1761 erfolgten Haydns Blitzschläge in Begleitung tanzender Regentropfen (dem Eröffnungsthema), sintflutartiger Schauer und möglicherweise noch anderer, bislang nicht identifizierter meteorologischer Erscheinungen.
Der bemerkenswerte langsame Satz von "Le midi" beginnt mit unverkennbaren Anklängen an das Recitativo accompagnato der Oper, samt jähen Umschwüngen in Stimmung und Material, Verzweiflungsgesten und einer unsteten tonalen Fortschreitung von c-Moll über g-Moll nach h-Moll. Wenn der anschließende Doppelkonzertsatz mit seinen schmetternden Flöten tatsächlich (wie Robbins Landon meint) Haydns Vision vom Elysium ist, muss die Introduktion den Hades darstellen. So gehört, bezieht sich dieser Satz auf allgemeinere Besonderheiten von Haydns Stil, insbesondere auf die Erhabenheit der Einleitungen seiner späten Symphonien und das "Lichtwerden" in der Schöpfung.
Daneben enthalten diese Symphonien außermusikalische Assoziationen ganz anderer Art. Die Adagiopassagen am Anfang und Ende des langsamen Satzes von "Le matin" beruhen auf der simplen Tonfolge "Sol-la-do-re-mi"(g - a - c - d - e), so als wären die Musiker Schüler, die mit dem Studium des Kontrapunkts Note gegen Note beginnen. Das geht soweit, dass sie das "Mi" (e) falsch spielen, woraufhin sie die Solovioline — der "Lehrer" — sogleich mit einer tremolierenden Wiederholung derselben Tonfolge korrigiert! Ab da machen die "Schüler" gute Fortschritte. Selbst die außergewöhnliche Concertante-Besetzung aller drei Werke könnte ihre programmatische Seite haben: Haydns außermusikalische Inspiration ließ sich wahrscheinlich leichter durch markante solistische Stimmführung als durch seine sonstige "kompakte" Orchesterführung darstellen.
Zum Abschluss sei hier Charles Rosens glänzende Interpretation der späten Haydn-Symphonien als "heroisch pastoral" zur Betrachtung angeführt:
Ihr direkter Verweis auf ländliche Natur ... ist nicht aufgesetzt, sondern wahrer Anspruch eines Stils, dessen Beherrschung der gesamten Bandbreite der Technik so groß ist, dass er es sich in seinem Erfindungsreichtum leisten kann, das äußere Erscheinungsbild hoher Kunst geringzuschätzen ... Haydns pastoraler Stil ... erhebt fröhlich Anspruch auf das Erhabene, ohne etwas von der Unschuld und Schlichtheit preiszugeben, die er durch seine Kunst erlangte. Mit gebührendem Respekt vor dem "Elysium" und dem Erhabenen wird hier, wie oben schon angedeutet, eine Brücke geschlagen zwischen Haydns letzten Londoner Schöpfungen und seinen frühesten Esterházy-Symphonien. "Experimente", fürwahr!
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
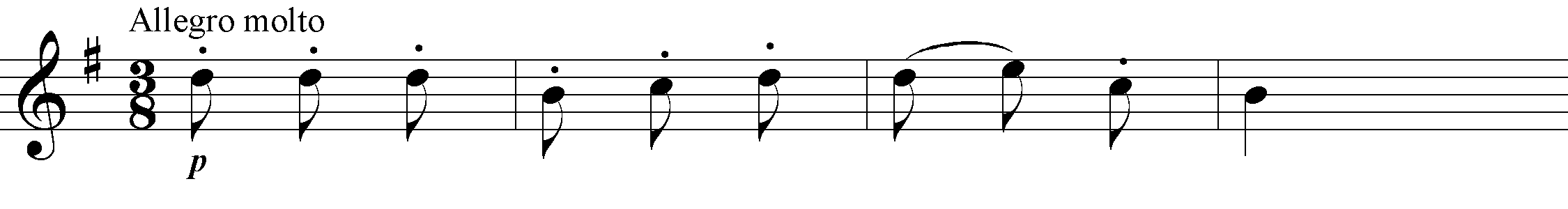
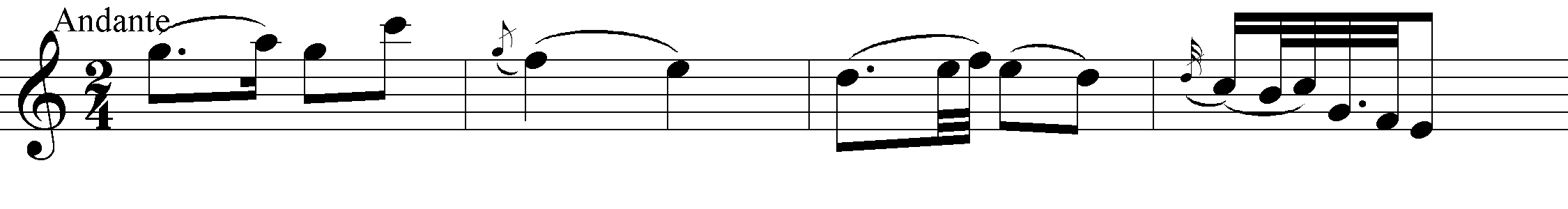
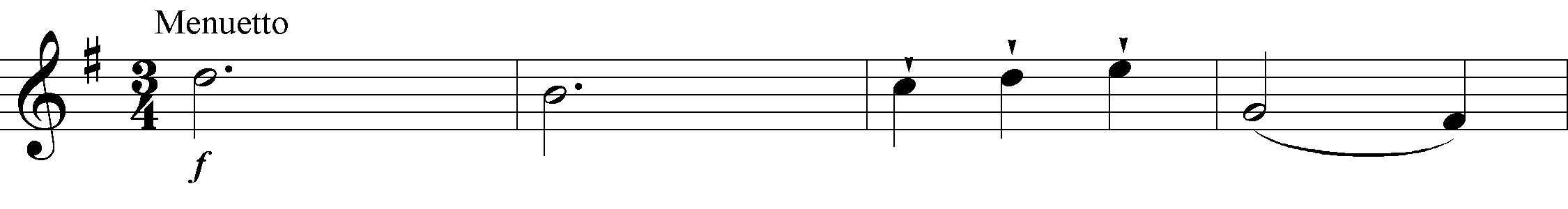
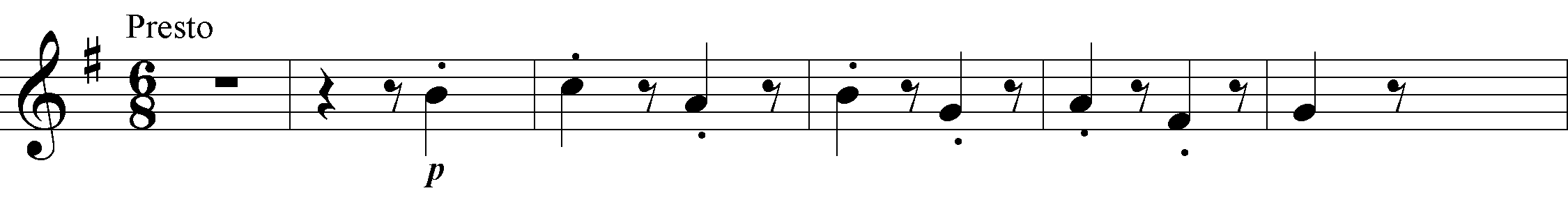
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)