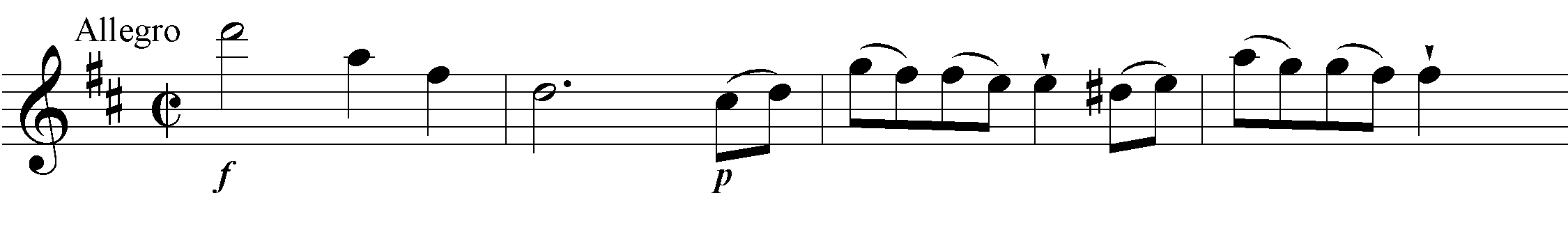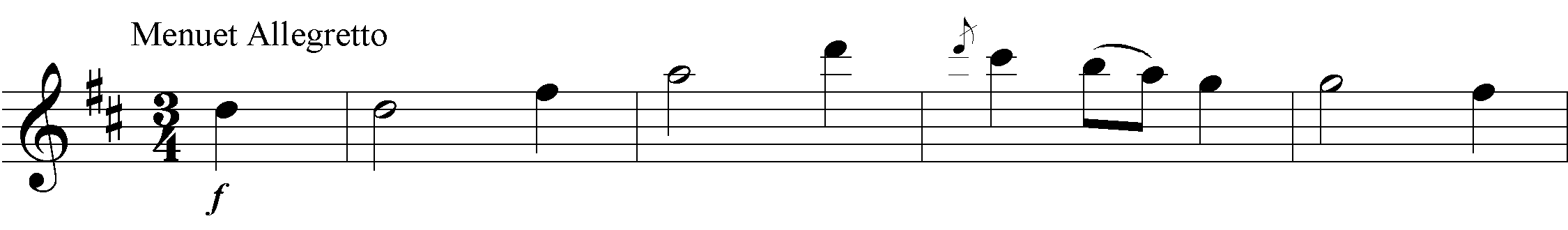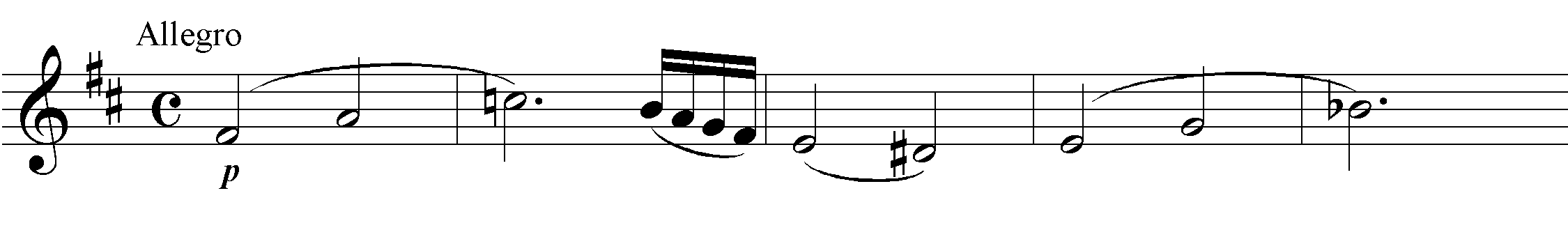62
D-Dur
Sinfonien um 1780/81
Herausgeber: Heide Volckmar-Waschk und Stephen C. Fisher; Reihe I, Band 10; G. Henle Verlag München
Hob.I:62 Symphonie in D-Dur
Dieses Werk zählt zu den ungewöhnlichsten Symphonien Haydns. Alle vier Sätze stehen ohne jeden Tonartwechsel in derselben Tonart (D-Dur): Dies findet sich in keiner anderen Haydn-Symphonie (außer in einigen viel früheren, die mit einem langsamen Satz beginnen). In allen Fällen, in denen Haydn etwas Unerwartetes unternimmt, kann nur eine bewusste künstlerische Entscheidung zugrunde liegen. Das erste Allegro lässt in der Kombination von einer belebten Oberflächenbewegung mit einem langsamen harmonischen Rhythmus erkennen, dass es ursprünglich eine Ouvertüre war. Die Durchführung ist dadurch bemerkenswert, dass sie hauptsächlich auf einer neuen, ruhigen Idee aufgebaut ist, die sich langsam in viertaktigen sequenzierenden Schritten bewegt; nur die Rückführung greift wieder das Material und die Stimmung des Vorangegangenen auf.
Der stilistische und psychologische Mittelpunkt dieser Symphonie ist der zweite Satz, welcher derjenige ist, der "fälschlicherweise" in der Tonika steht. Er ist als Allegretto bezeichnet; d. h. nicht langsam. Der Charakter dieses Satzes ist beinahe einzigartig fur Haydn: ätherisch, delikat, ein wunderbarer Traum bzw. eine schöne Träumerei. Die Stimmung des Anfangs — die hohen Streicher im Piano, Violinen mit Dämpfer, pausierende Bässe — scheint nicht dem Material zu entsprechen, das Charles Rosen beschreibt als "den möglichst geringsten Aufwand — zwei Noten und eine banale Begleitung". Diese Fetzen werden in der Art eines rudimentären umkehrbaren Kontrapunkts (die tieferen Streicher treten bald hinzu) dargestellt; d. h. sie deuten sowohl auf einen geistigen wie materiellen Gehalt hin. Im Verlauf der Exposition setzen die Bläser nacheinander und paarweise ein: die Flöte innerhalb der Überleitung zur Dominante, Oboen und Fagotti bei der ersten Kadenz in die Dominante (der Rhythmus wird komplexer), und die Hörner (das volle Orchester nun im Forte) schließlich zu Beginn des letzten Abschnitts der Exposition, deren Schluss sich jedoch wieder ins Ätherische verflüchtigt. Nach einer kurzen Durchführungsepisode in Moll fügt die Reprise zum ersten Thema eine anmutige Gegenmelodie und eine Erweiterung und Intensivierung der rhythmisch komplexen Passage (statt des Forte des vollen Orchesters) hinzu, und zwar vor den Schlusskadenzen und einer kurzen, ruhigen Coda. Das Menuett ist (an den Maßstäben Haydns gemessen) unkompliziert, während das Trio in der Subdominante und mit seinem Fagottsolo das berühmte synkopierte Trio der "Oxford-Symphonie" vorausahnen lässt, das in derselben Tonart steht. Das Finale in der großangelegten Sonatenhauptsatzform beginnt nicht in der Tonika, was später zu vorhersehbar unvorhersehbaren Konsequenzen führt. Dieser nicht-tonikale Beginn ist wegen der bis dahin (sozusagen) übermäßigen D-Zentrierung der Symphonie zweifellos sinnvoll. Von den vier Sätzen ist das Finale der zugleich am intensivsten durchgearbeitete Satz, der am Schluss ein entsprechendes Gespür für den Höhepunkt erkennen lässt.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
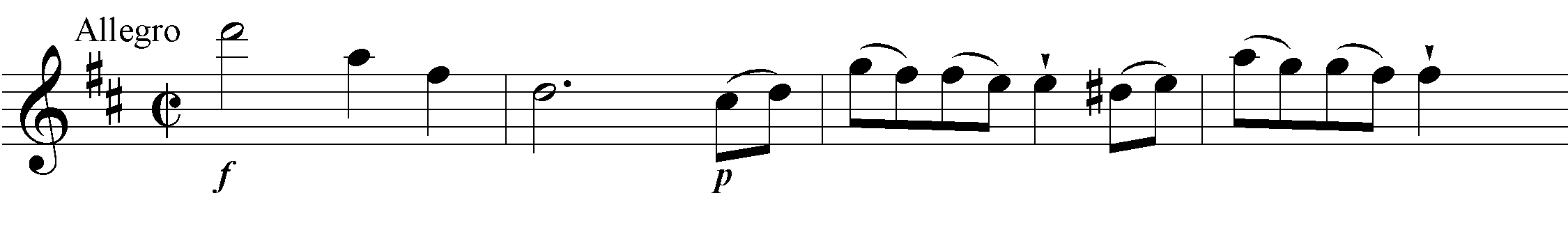

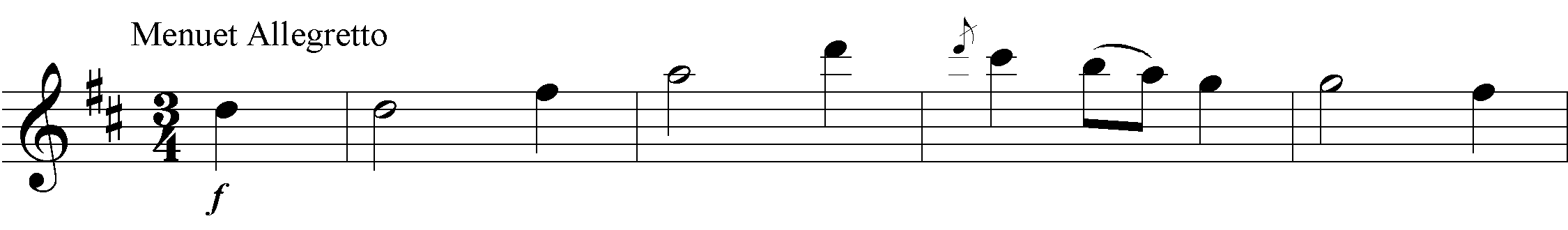
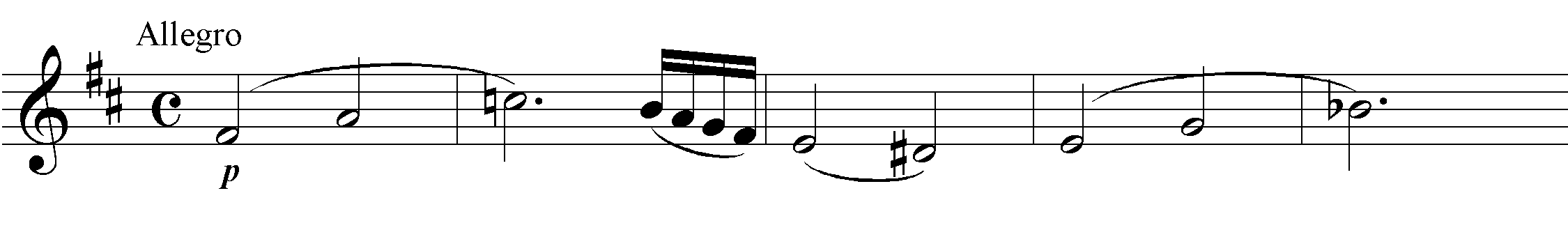
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)