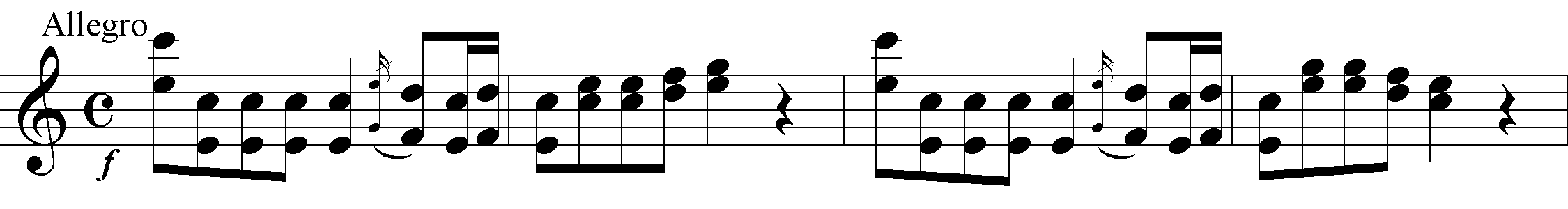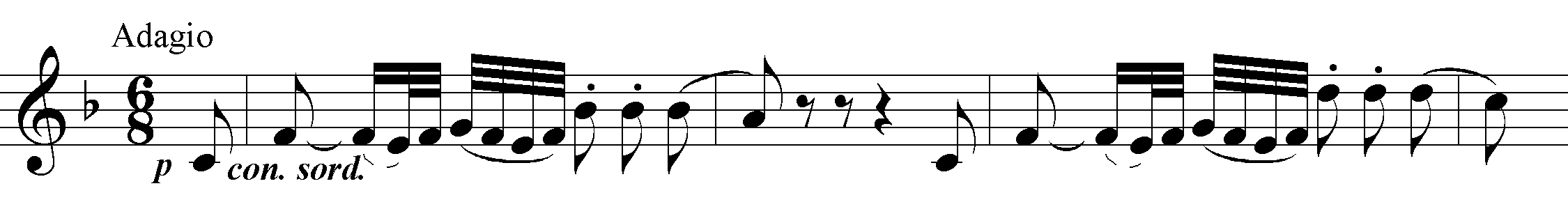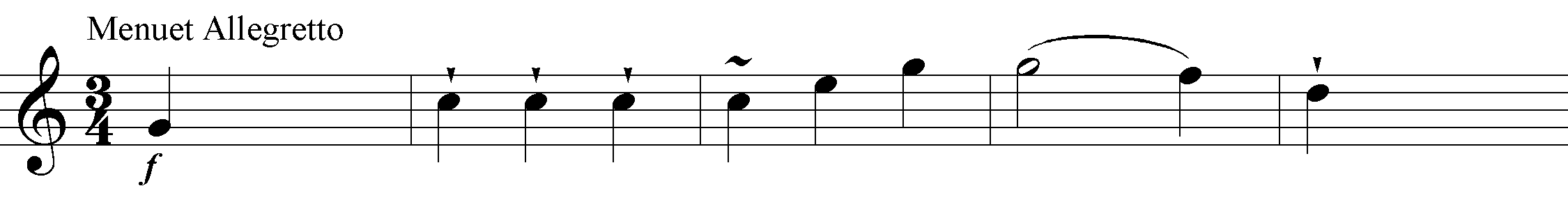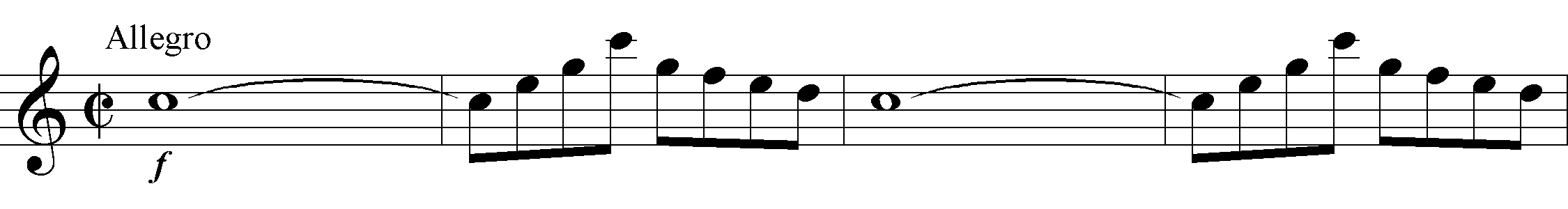48
"Maria Theresia"
C-Dur
Sinfonien um 1766-1769
Herausgeber: Andreas Friesenhagen und Christin Heitmann; Reihe I, Band 5a; 2008, G. Henle Verlag München
Hob.I:48 Symphonie in C-Dur
Dieses Werk hat nichts mit Maria Theresias Besuch im Schloss Eszterháza im Jahre 1773 zu tun. Es muss ungefähr 1768/69 entstanden sein; das ihm verwandteste C-Dur-Werk ist deshalb die Symphonie Nr. 41 (siehe Folge 5). Auf der anderen Seite ist Nr. 48 nicht nur länger sondern auch großartiger, und man kann verstehen, warum sie festliche, ja königliche Assoziationen weckte.
Der erste Satz ist sehr breit angelegt; in Teilen erinnert er an eine Prozession. Im ersten Thema wechseln sich Bläserfanfaren mit langen Streicherpassagen ab; das großangelegte zweite Thema umspannt vier gehaltvolle und sehr unterschiedliche Abschnitte, die wiederum zahlreiche innere Gegensätze enthalten. Die ausgedehnte Durchführung gipfelt in einem ungeheuren sequenzierten Abschnitt, der auf dem ersten Abschnitt des zweiten Themas basiert; seine Schlussphrase, kurz vor der Ankunft auf der Dominante der Haupttonart, muss die verblüffend ähnliche Passage in Mozarts "Jupiter-Symphonie" beeinflusst haben: dieselbe Tonart, dieselben Formmerkmale, die gleiche Auftaktfigur, und in der Durchführung die gleiche Modulation (Haydn in den Takten 114-119; Mozart in den Takten 171-179).
Das wunderschöne und entspannte Adagio in Sonatenform ist einer von Haydns ausgedehntesten langsamen Sätzen. Die Bläser sind ungewöhnlich exponiert, die Oboen haben Soloeinwürfe im ersten Abschnitt (noch auf der Tonika) und die Hörner übernehmen die Führung — ein Umstand, der später noch Folgen haben wird. Das zweite Thema ist auch sehr lang. Während sich die Triolenmotive mehr und mehr ausbreiten, führen sie zu zahlreichen Scheinkadenzen, jede einzelne verschieden, und jede zu einer anderen Erweiterung führend. Nach einer relativ kurzen Durchführung wird die Reprise durch einen erstaunlichen Einfall eingeführt. Sowie die Musik die Dominante A von d-Moll erreicht, hält sie plötzlich an; die Oboen und Hörner bringen das A im Oktavabstand im pianissimo (immer ein signifikantes dynamisches Zeichen bei Haydn); und plötzlich spielen dann die Hörner wieder A als Terz der Tonika F-Dur und intonieren ihre Melodie aus dem zweiten Abschnitt des ersten Themas. Das klingt alles erstaunlich romantisch. Haydn kehrt erst dann zur Ausgangsdominante und der eigentlichen Reprise zurück und beginnt mit dem originalen ersten Abschnitt.
Das Menuett kehrt zur festlichen Stimmung des Allegro zurück und behält die ungewöhnlich großen Dimensionen bei, die für die ganze Symphonie charakteristisch sind. Gegen Ende bricht es in eine kriegerische Fanfare in Oktaven im ganzen Orchester aus; wie so oft ist aber die Schlussphrase ruhig. Das Trio steht in der Molltonika; es ist ebenfalls ziemlich lang und schließt mit einer ausgedehnten chromatischen Fortschreitung, die erst im letzten Moment wieder zur Tonika zurückkehrt.
Das stürmische Alla breve-Finale steht in entschiedenem Gegensatz zu dem prozessionsähnlichen Anfangssatz (obwohl das "Jupiter"-Motiv einen flüchtigen Eindruck hinterlässt). Sobald die Überleitung begonnen hat, eilt die Musik ohne Atempause das ganze Stück bis zum Doppelstrich. Als Ausgleich dazu beginnt die Durchführung ruhig mit einem langen Halteton, der in die Molltonika moduliert; dies führt schließlich zur "unmittelbaren Reprise" (man vergleiche Symphonie 43/i). Danach stürzt sich die Durchführung wieder kopfüber in die Reprise und zu ihrem Ende.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
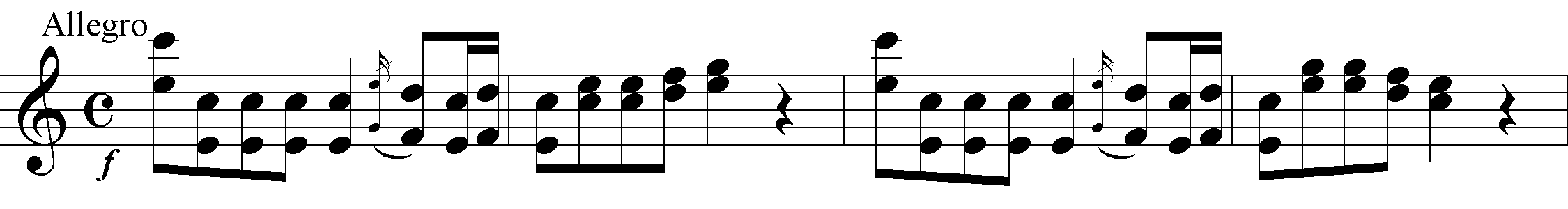
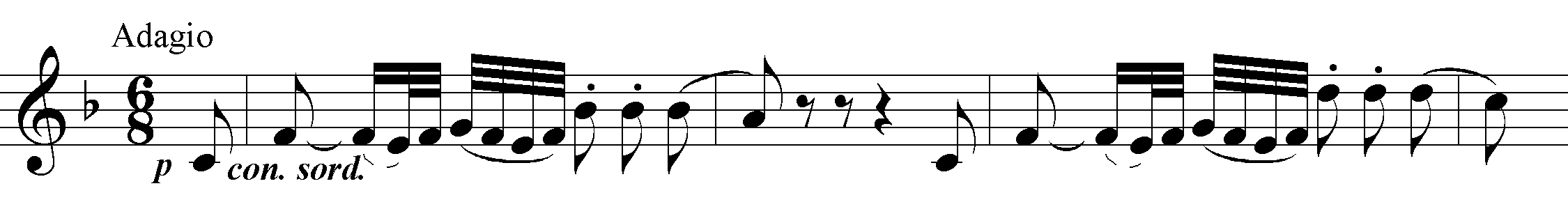
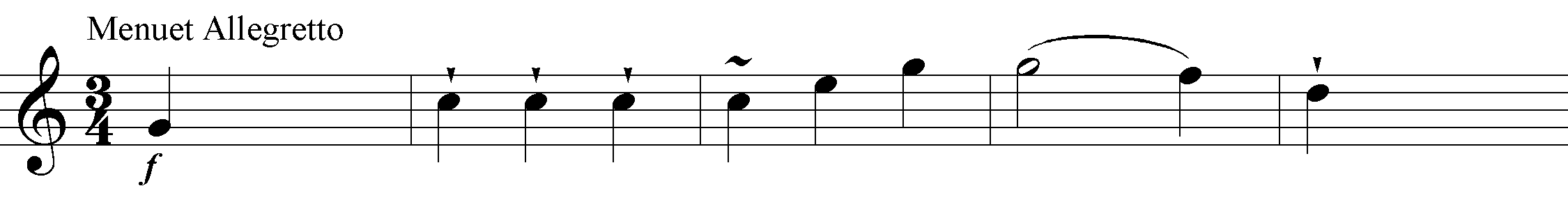
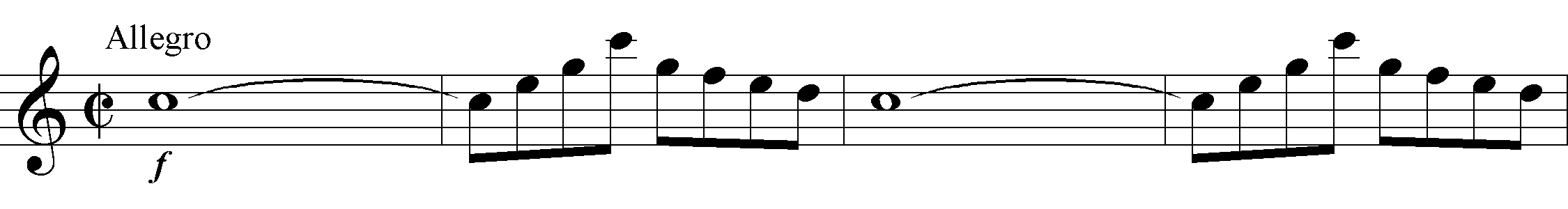
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)