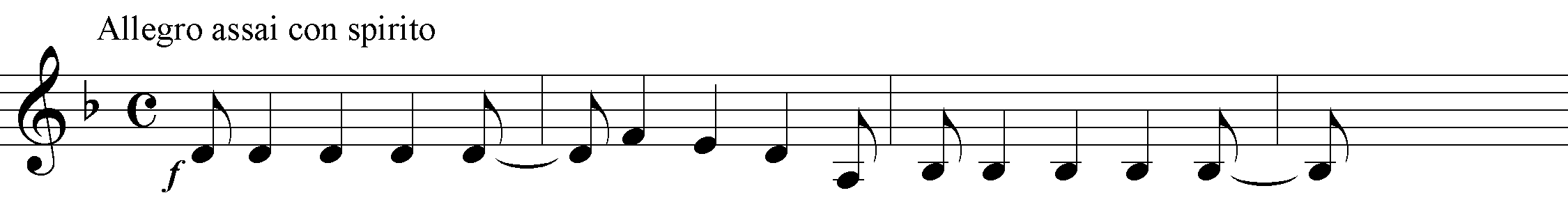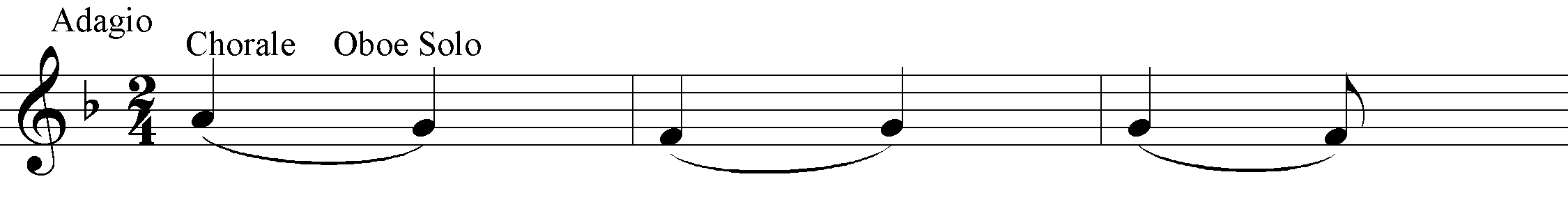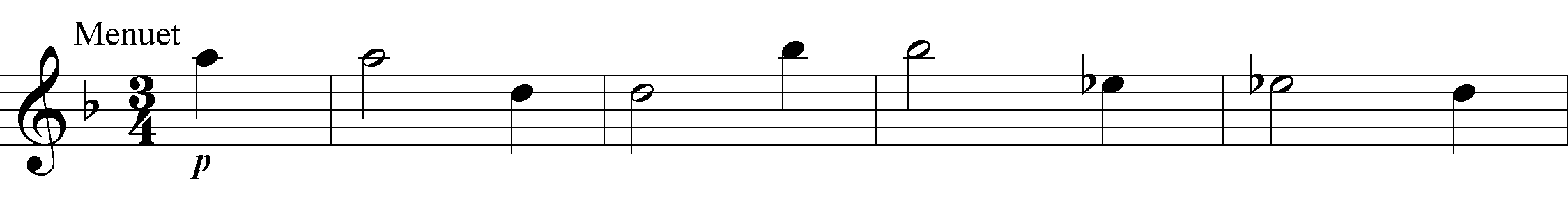26
"Lamentatione"
d-Moll
Sinfonien um 1766-1769
Herausgeber: Andreas Friesenhagen und Christin Heitmann; Reihe I, Band 5a; 2008, G. Henle Verlag München
Hob.I:26 Symphonie in d-Moll ("Lamentatione")
Dieses dreisätzige Werk ist eine "Oster"-Symphonie. Die älteste überlieferte Quelle ist mit "Passio et Lamentatio" überschrieben, und die beiden ersten Sätze benutzen Material aus traditionellen österreichischen musikalischen Passionsspielen. Haydns kompositorische Vorgehensweise ist dementsprechend ungewöhnlich.
Das Allegro assai con spirito beginnt mit einem synkopischen forte-Thema in Haydns bester "Sturm und Drang"-Manier, gefolgt von einigen langsamen piano-Phrasen. Unvermittelt wechselt die Musik dann in die Paralleltonart (F-Dur), in der das erste liturgische Thema fortissimo in einer Oboe und in den zweiten Violinen zu hören ist. Dieses Thema ist in drei Abschnitte unterteilt: eine "deklamatorische" forte-Melodie über einem rhythmischen ostinato, eine schrittweise piano-Melodie in längeren Notenwerten und eine höhere Variante der "deklamatorischen" Melodie. Diesen Abschnitten entsprechen jeweils Worte des Evangelisten ("Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Marcum. In illo tempore"), Jesu ("Ego sum") und der Juden ("Jesum Nazarenum"). Das Ganze ist von durchlaufenden Achteln in den ersten Violinen umspielt, die die Bewegung erhalten und das Thema rhythmisch mit dem größeren Kontext verbinden.
Die relativ kurze Durchführung basiert hauptsächlich auf dem synkopischen Anfangsthema (obwohl die Worte Jesus' kurz wiederholt werden). Die Exposition wird auch ohne Veränderung wiederholt bis ein Halteton etwas Ungewöhnliches ankündigt — das sich als Reprise des gesamten zweiten Themas in der Durvariante der Tonika (D-Dur) entpuppt, inklusive des Passionsthemas. Der Effekt ist nicht nur überraschend, sondern auch höchst ungewöhnlich: Dies ist der erste Sonatensatz in Moll, den Haydn in Dur beendet, eine Kompositionsweise, die er erst wieder 1782 anwendete. Durch diesen Schluss im "falschen" Tongeschlecht wollte er sicher nicht nur eine alte Passionsmelodie zitieren, sondern auch ihre Bedeutsamkeit hervorheben: gleichzeitig schaurig und doch voller Hoffnung.
Eine weitere Folge dieses Schlusses besteht darin, dass das Adagio in einer entfernten tonalen Verwandtschaft beginnt (F-Dur und D-Dur); auch so etwas hatte Haydn nie zuvor getan. Das Adagio basiert auf einer weiteren liturgischen Melodie, die ebenfalls von den Oboen und zweiten Violinen gespielt wird, wieder unterstützt durch eine Melodie in den ersten Violinen. Aber hier setzt diese Melodie sofort ein. Sie ist eine originale Wehklage aus einer Sammlung von Melodien, die alphabetisch geordnet sind ("aleph", "beth", usw.). Der Text beginnt mit "Aleph. Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae". Haydns Satz, mit den Violinen, die die langsame melodisch begrenzte liturgische Melodie umspielen, unterstützt von einem gehenden Bass (Pilger?), ruft eine seltsame Mischung von Begrenzung und Entrückung hervor. Zwei erwähnenswerte Details sind die wundervolle Steigerung, wenn das Horn am Beginn der Reprise einfällt, und ein Moment tonaler Ambivalenz kurz vor Ende, die dann die vorhergehende D/F-Polarität aufzeigt.
Das Menuett-Finale bereitet Interpretationsprobleme, teilweise weil von großen Symphonien vier Sätze erwartet werden, teilweise weil das Menuett Assoziationen des galanten Stils weckt. Und trotzdem ist dieser streng konzentrierte Satz in mehrfacher Hinsicht der intensivste von allen. Von Anfang an erzeugen der tonartlich nicht fixierte Beginn, die rhythmisch instabilen Motive, die neapolitanische Harmonik und der zweideutige Phrasenrhythmus eine bedrückte Stimmung. Bis zur Reprise erscheint keine festgelegte Tonika — und selbst die ist instabil. Der Bass bringt das Thema einen Takt "zu früh", so dass dann, wenn die Melodie "richtig" einsetzt, ein außergewöhnlicher, sich steigernder Kanon entsteht, der sich gen Himmel zu erheben scheint — dieser Kanon dominiert die Reprise, bis er auf einem dissonanten Akkord abrupt abbricht; die Schlusskadenzen folgen dann ganz in Ruhe. (Hier kündigt sich Mozart an, vor allem das Adagio und Fuge für zwei Klaviere, KV 426, und das d-Moll Klavierkonzert). Obwohl es müßig ist, darüber zu spekulieren, wie ein Hörer im 18. Jh. diesen Satz in Zeiten der Passion gehört haben mag, ist es sicher ernsthaft genug, um diese bemerkenswerte Symphonie zu beschließen.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
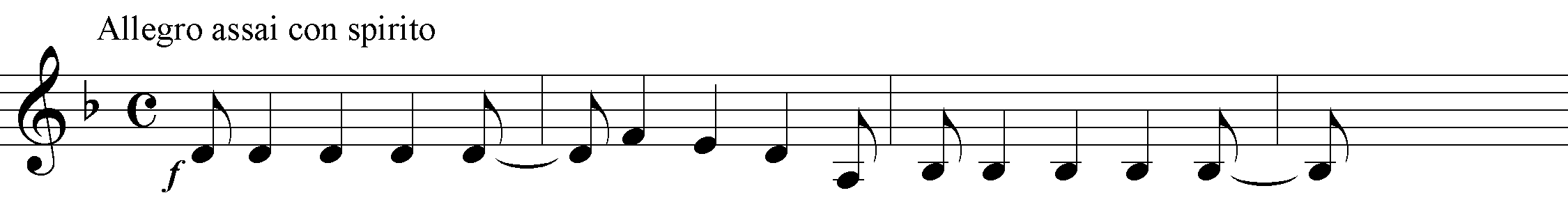
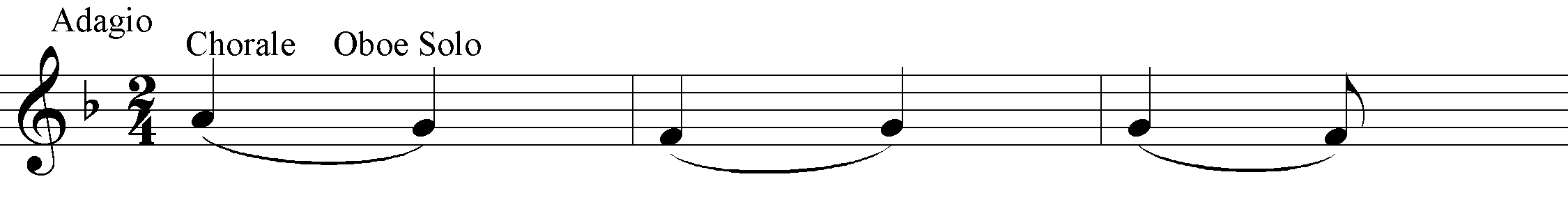
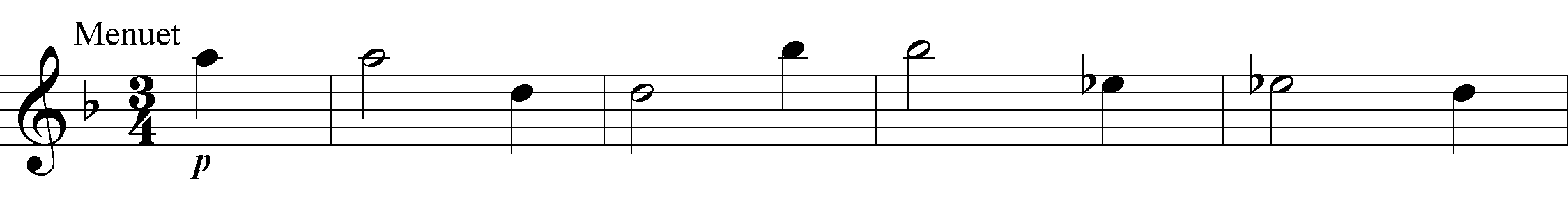
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)