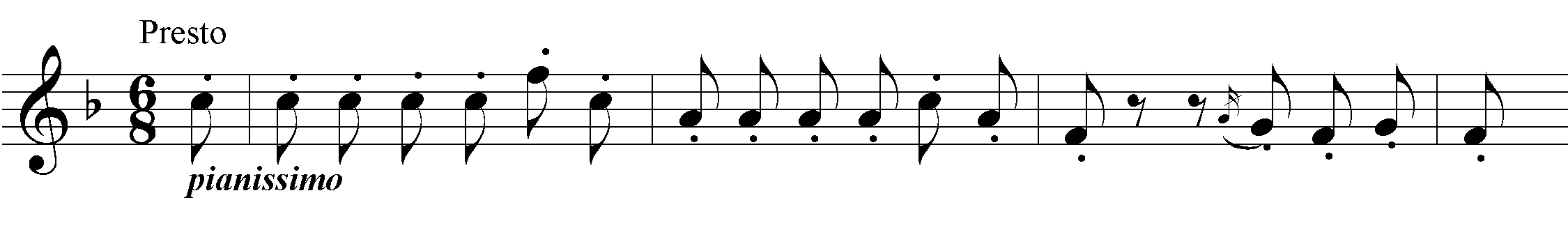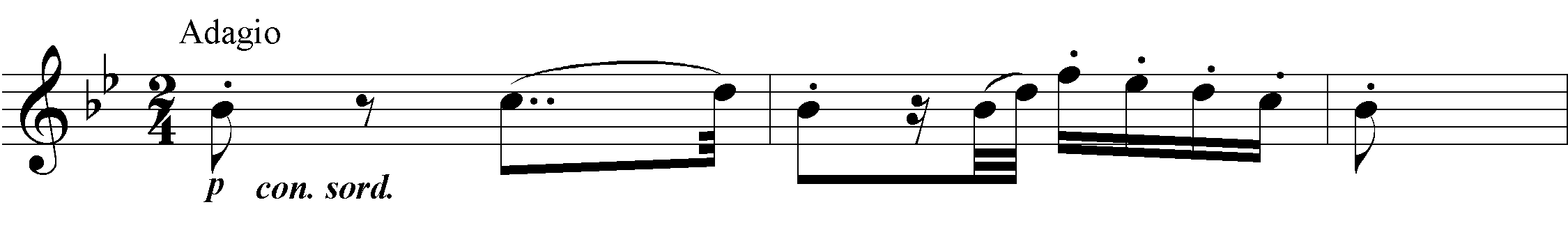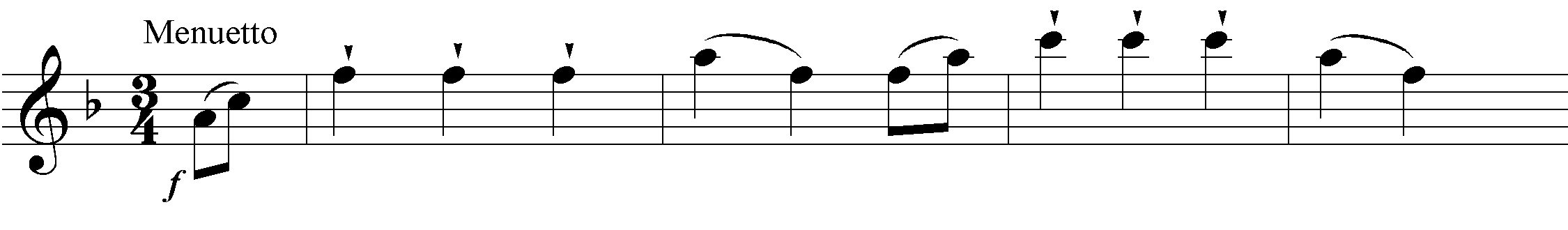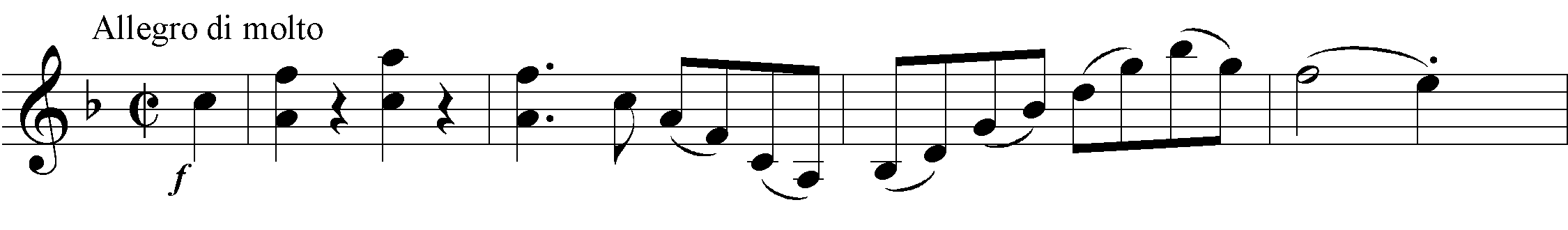67
F-Dur
Sinfonien um 1775/76
Herausgeber: Sonja Gerlach und Wolfgang Stockmeier; Reihe I, Band 8; G. Henle Verlag München
Hob.I:67 Symphonie in F-Dur
Dies ist eine der besser bekannten Symphonien aus dieser Periode, was sie ihrem lebendigen ersten Satz, verschiedenen speziellen (weiter unten beschriebenen) Wirkungen und dem formal einzigartigen Finale verdankt. Der Hauch der Bühne scheint greifbar zu sein, obwohl es keinen konkreten Hinweis auf eine derartige Verbindung gibt.
Der erste Satz weist mit Presto 6/8 eine Kombination von Tempo und Takt auf, die für einen ersten Satz unüblich ist und die man gewöhnlich in einem Finale erwarten würde. Jedoch entwickelt das spritzige Dreiklangs-Hauptthema des ersten Satzes, bevor es kadenziert, ein unerwartetes Maß an Empfindung. Die leidenschaftliche Exposition schafft Raum für ein wirkliches "zweites Thema" in der Dominante. Später jedoch wird die vorherrschende Einfachheit der Satztechnik durch eine kanonische Episode in der Durchführung gestört, auch wenn der letztere Abschnitt unüblicherweise entspannt beginnt und endet.
Der langsame Satz gehört, zusammen mit dem der Symphonie Nr. 68, zu einer bestimmten Unterart, die für diese Periode charakteristisch ist: Adagiosätze in der Sonatenhauptsatzform, in denen die Violinen mit Dämpfern spielen und die auf kurzen, aphoristischen Phrasen beruhen, mit der Tendenz, sich in eine delikate Filigranarbeit aufzulösen. Jedoch schwanken sie in der Stimmung doppeldeutig zwischen Komödie und Empfindung. Sie sind in keinem Sinn "populär". Hier tritt diese stilistische Mischung in der Durchführung am deutlichsten hervor; der zentrale Abschnitt derartiger Sätze besteht aus einer außergewöhnlich "ruhigen" filigranen Passage, hier ein ausgedehnter Kanon der beiden Violinpartien, der von beiden Seiten durch die expressivsten Passagen des Satzes umschlossen ist. Jedoch ist Haydns letztes Wort von absoluter Komik: Die zarte Anfangsphrase wird als Ganzes col legno wiederholt.
Das kurze, ungestüme Menuett bereitet das bemerkenswerte Trio vor, das für die zwei ersten Violinen alleine mit Dämpfern geschrieben ist; die erste Violine schmettert in den Höhen etwas, was möglicherweise eine "Volksmelodie" ist, während die zweite einen Bordunbaß spielt und zudem die erste Violine mit Doppelgriffen begleitet: Die beiden Spieler spielen auf diese Art und Weise nicht bloß formal ein "Trio", sondern auch im eigentlichen Sinn des Spielens von drei musikalischen Stimmen. Der Scherz findet jedoch seine Fortsetzung: da der Satz in F steht, muss die zweite Violine, um den Bordun auszuführen, ihre G-Saite einen Ganzton tiefer stimmen.
Das Finale setzt mit dem Alla breve und der Tempobezeichnung Allegro di molto, die "eigentlich" für einen ersten Satz charakteristisch sind, das Vertauschen von Satztypen fort. Es steht in der Form der "Da Capo-Ouvertüre", wie sie weniger treffend bezeichnet ist ("Re-prisenouvertüren"-Form scheint angemessener zu sein): eine vollständige Exposition, die in der Dominante schließt, und eine vollständige Reprise, jedoch mit einem kontrastierenden Mittelteil in einem anderen Tempo anstelle der Durchführung. Das Allegro könnte konventionell erscheinen, auch wenn sein ganz eigenes "zweites Thema" für Haydn ungewöhnlich ist. Am Ende der Exposition wechselt er, für ein "anderes" Trio aus Solisten, abrupt zu einem Adagio e cantabile und einem 3/8-Takt. Hier haben wir jedoch ein "wirkliches" Trio, das aus den zwei ersten Violinen und dem ersten Cello besteht. Sie fuhren, mit Wiederholungen, ein vollständiges zweistimmiges Thema in der Tonika aus; das volle Orchester tritt im letzten Abschnitt hinzu, was zu einer zauberhaften Wirkung führt. Ein vollständiges zweites Thema, das die Bläser hervorhebt, folgt in der Subdominante; das Anfangsmotiv ist identisch mit dem der Missa Sancti Nicolai von 1772, auch wenn es in einer anderen Tonart steht. Schließlich windet sich die Musik zur heimischen Dominante, woraufhin das Allegro di molto, als hätte sich nichts Ungewöhnliches ereignet, mit einer vollständigen Reprise fortfährt — bis ein einfaches Motiv aus drei Noten als abschließender Buffo-Einfall über einem zupackenden Ostinato in den Violinen leise vergeht.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
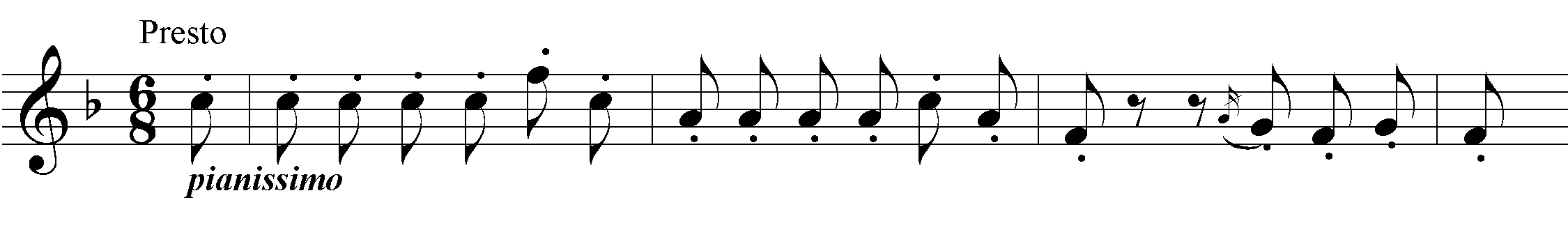
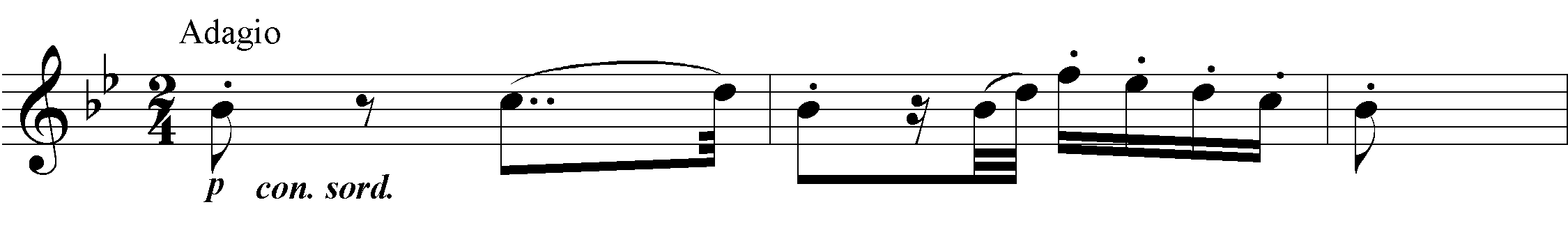
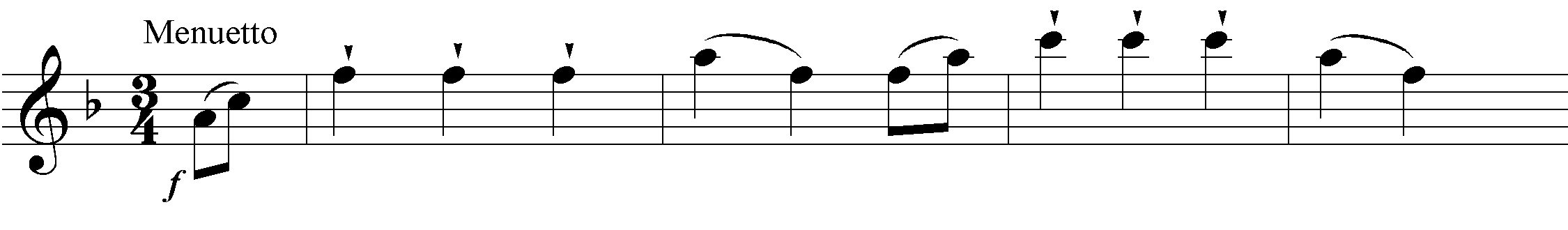
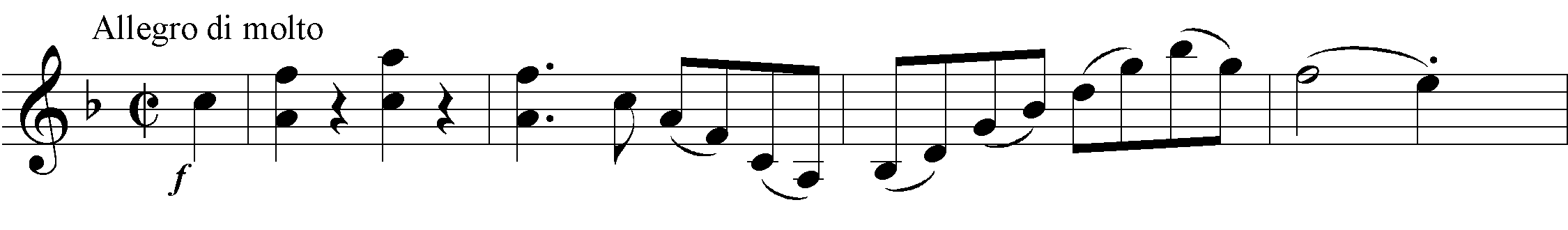
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)