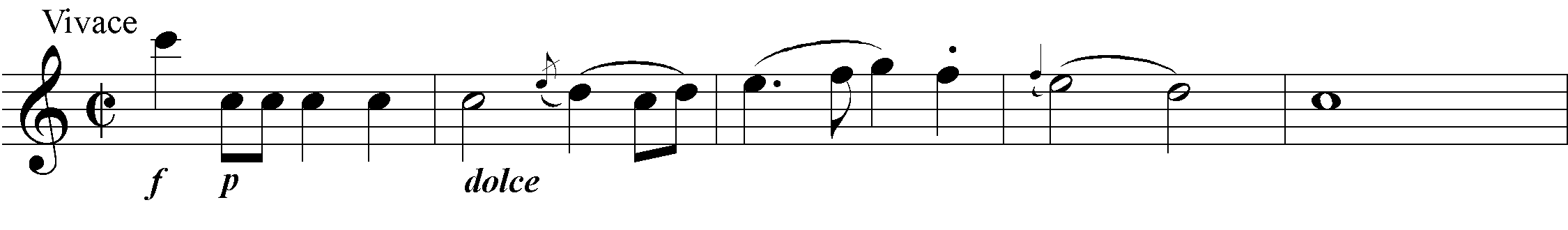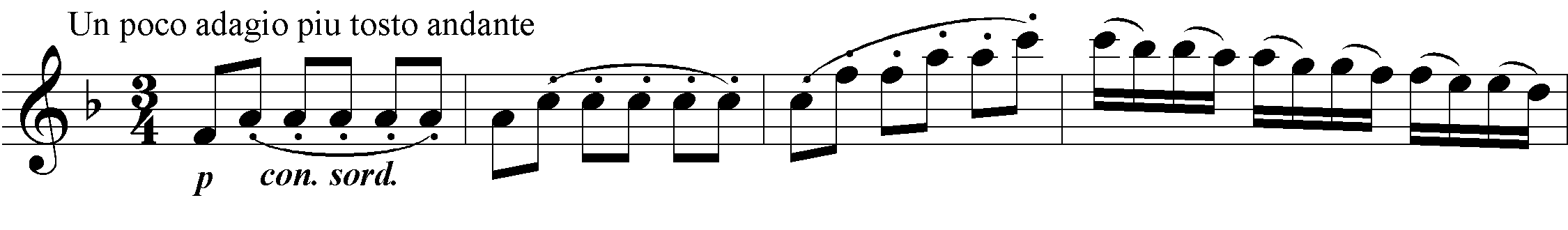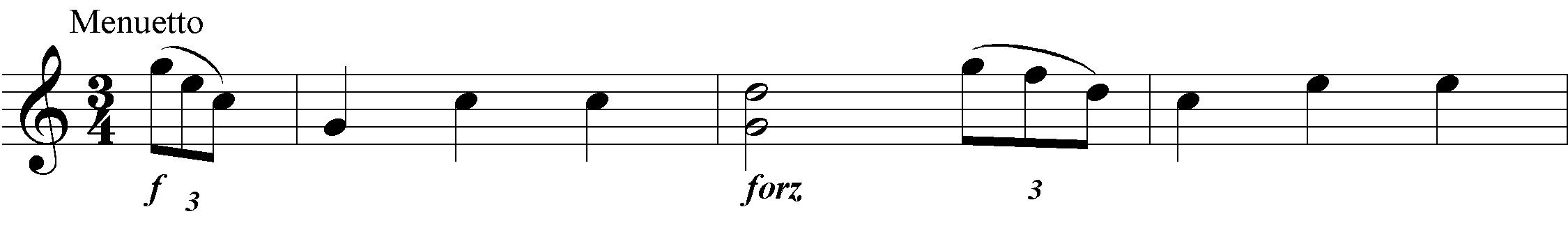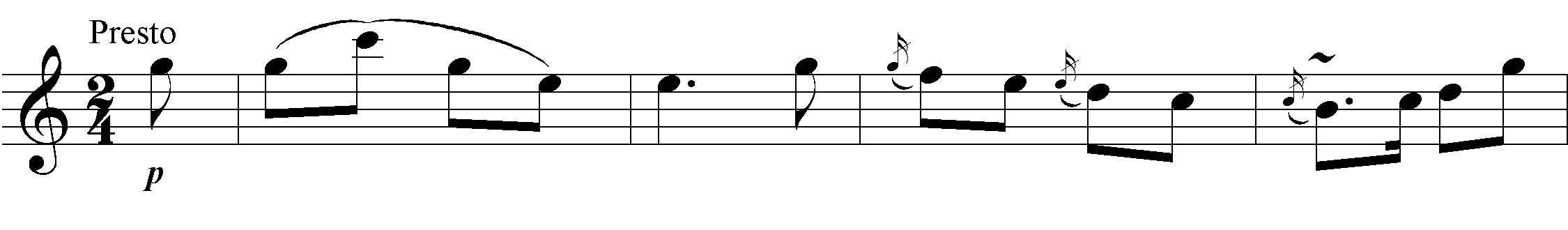69
"Laudon"
C-Dur
Sinfonien um 1775/76
Herausgeber: Sonja Gerlach und Wolfgang Stockmeier; Reihe I, Band 8; G. Henle Verlag München
Hob.I:69 Symphonie in C-Dur ("Laudon")
Diese Symphonie verkörpert mehr als jede andere in dieser Folge den Aspekt des "leichten Hörens" in der Kunst Haydns aus dieser Periode. Den Beinamen hat sie von einem berühmten österreichischen Feldmarschall erhalten; es war nicht der Einfall Haydns, dem Werk diesen Beinamen zu geben, sondern der seines Verlegers Artaria, der ihn für eine Bearbeitung für Clavier allein verwendete. Haydn billigte ihn jedoch eher zynisch:
Das letzte oder 4te Stück dieser Symphonie ist für das Clavier nicht practicabl, ich finde es auch nicht für Nothig dasselbe beyzudrucken: das wort Laudon wird zu Beförderung des Verkaufes mehr als zehen Finale beytragen.
Das Werk steht durchgehend in der Durtonart, ist unmittelbar zugänglich und satztechnisch mit leichter Hand gearbeitet; es bewegt sich innerhalb vertrauter Stile und Konventionen und weist nur wenige Stellen von expressiver Intensität auf; die ausgedehnten Abschnitte, thematischen Gruppen, Überleitungen usw. sind kristallklar. Der Beginn des ersten Satzes ähnelt dem der besser bekannten Symphonie Nr. 48, "Maria Theresia" (ca. 1768); er steht in derselben Tonart, jedoch kann man seinem Verlauf leichter folgen; sogar die Durchführung deutet keine entfernten Tonarten an, und es finden sich in ihr nicht so viele Spuren kontrapunktischer Komplexität.
Der langsame Satz, obwohl gleichermaßen einfach gehalten, ist im Gegensatz dazu entschieden exzentrisch. Sein aufsteigendes Dreiklangsthema mit Tonwiederholungen geht in gewundene Sechzehntel über, die sich jedoch als unfähig erweisen, die Tonika zu verlassen. Nur nach ihrer Übernahme durch den Bass folgt eine grobe Modulation zur Dominante; die zweite Gruppe weist wenigstens eine Verbeugung vor der Molltonart sowie ein reizvoll keckes hemiolisches Hoketusthema auf. Die Durchführung ist ereignislos, und nur Toveys "Verteidigung" könnte die scherzhafte Rückführung mehr als Routine erscheinen lassen. Selbst wenn Haydn sich anscheinend nicht auf die nahe liegende Aufgabe konzentriert, muss er zugegebenermaßen einfach "ein wirklich neues Menuett" schreiben: so ist beispielsweise auf die überraschende Akzentverschiebung in die Mitte der Triolenfigur hinzuweisen. Das reizvolle Rondofinale in der Sonatenhauptsatzform scheint mehr beschäftigt zu sein und ist sicherlich fesselnder. Die Kontur der Melodie ist anders als erwartet; die zweite Gruppe in der Dominante brilliert mit Tremolos, überraschend entfernten Akkorden, lebhaften synkopierten Rhythmen usw. Die mittlere Episode, ein Minore, zeigt wirkliche Leidenschaftlichkeit, auch wenn die Überleitung, auf einem charakteristischen rhythmischen Motiv über geheimnisvollen langsam wechselnden Harmonien, länger dauert als wir es uns wünschten. Eine imitatorische codaartige Erweiterung geht dem Aufschwung voran, worin wiederum der "Unterhaltung" das letzte Wort gegeben wird.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
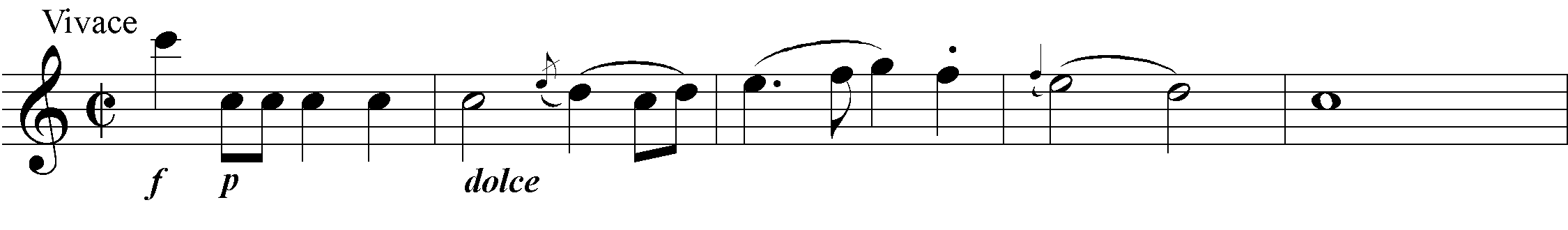
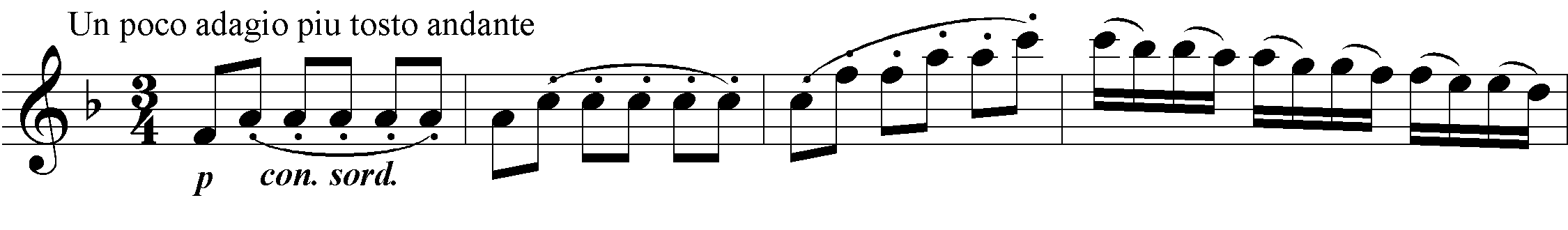
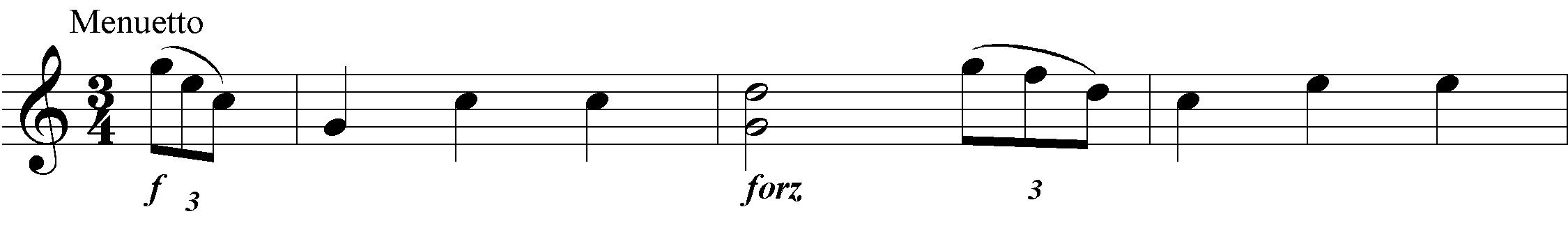
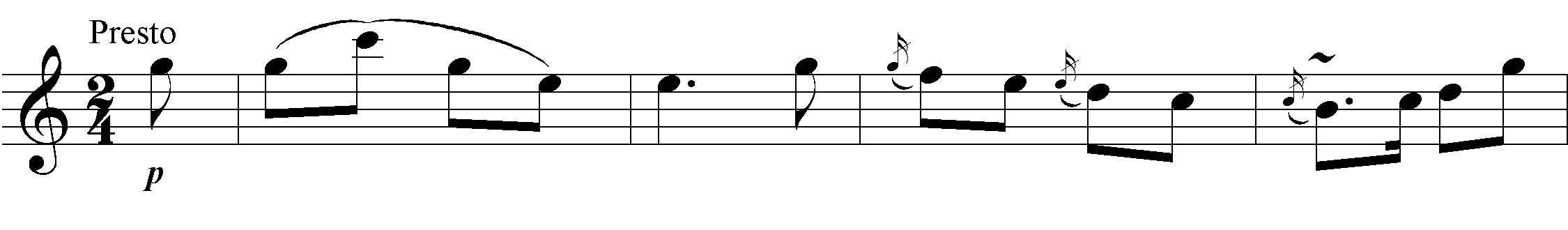
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)