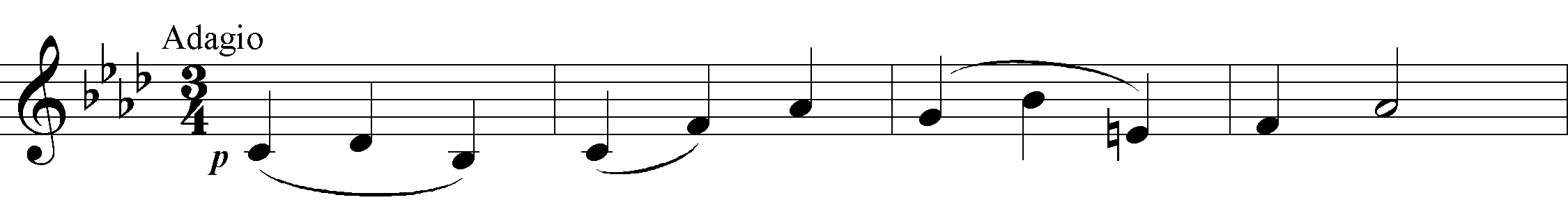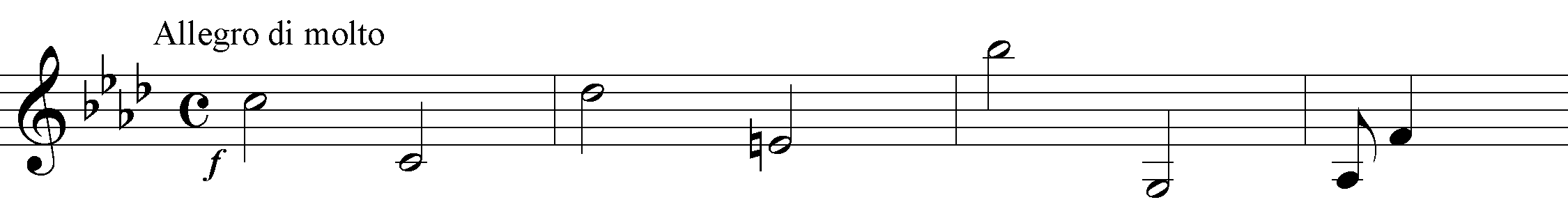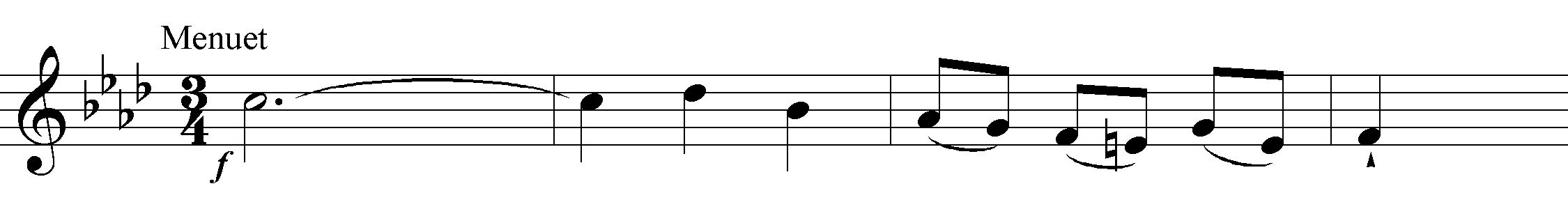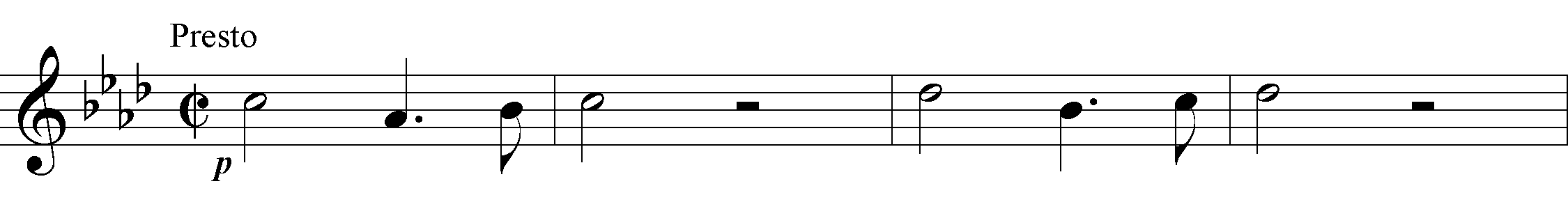49
"La passione"
f-Moll
Sinfonien 1767-1772
Herausgeber: Carl-Gabriel Stellan Mörner; Reihe I, Band 6; G. Henle Verlag München
Hob.I:49 Symphonie in f-Moll ("La passione")
Der Beiname dieses Werkes ist nicht authentisch, und es gibt auch keinen Beweis, dass sie irgendetwas mit Ostern oder mit liturgischen Funktionen zu tun hat. In Wirklichkeit erscheint im Gegenteil ein ganz anderer Name, "II quakuo di bel humore" (Der gutgelaunte Quäker), viel öfter in den Quellen des 18. Jahrhunderts (obwohl sogar diese nicht authentisch sind). Moralisierende Quäker waren in mitteleuropäischen Dramen ein beliebtes Thema; man vermutete, dass die vorliegende Symphonie, gleich anderen von Haydn aus dieser Periode, vielleicht als Musik in einem Theaterstück gespielt oder sogar dafür komponiert wurde. Sicherlich rufen ihre Intensität und ihre Exzentrik manche außermusikalischen Assoziationen hervor.
Dieses Werk ist die letzte der sechs Haydn-Symphonien, die die Variante der üblichen viersätzigen sinfonischen Form aufweisen, in der der langsame Satz am Anfang der Symphonie steht. Er wird von einem schnellen Satz, dem Menuett und einem schnellen Finalsatz gefolgt. Diese langsamen Eröffnungssätze sind länger und langsamer als jene, die an zweiter Stelle stehen, während die schnellen zweiten Sätze meistens kürzer und konzentrierter sind als die schnellen Anfangssätze. Darüber hinaus, wieder im Gegensatz zum Normalfall, stehen alle vier Sätze in der gleichen Tonart. Diese Umstände scheinen Haydn dazu geführt zu haben, dass er einen besonders ernsten Ton einschlug und sich um eine große harmonische und klangsprachlich-inhaltliche Kontinuität bemühte.
Tatsächlich ist diese Symphonie unbestreitbar die am stärksten vereinheitlichte, die Haydn bis dato komponiert hatte. Alle vier Sätze stehen in der Molltonika (eine Ausnahme gibt es nur im Trio des Menuetts) und sind ernst im Ausdruck. Außerdem kultivieren alle drei Sonatensätze mit voller Absicht die Diskontinuität der rhetorischen Themen, der harmonischen Fortschreitungen, der Dynamik, des Bläsereinsatzes, und vieles andere mehr. Innerhalb der f-Moll-Tonika betont Haydn übermäßig die Dominante C. Alle fünf Sätze (das Trio für sich gezählt) beginnen auf diesem Ton und arbeiten ihn mit Varianten des Motivs c—des—b—c, völlig unverziert am Anfang des Werks zu hören, weiter aus. In allen drei Sonatensätzen kreist die Durchführung ganz ungewöhnlich um die Dominante in der Molltonart (c-Moll) und die Rückkehr zur Tonika in der Reprise ist harmonisch und gestisch instabil. Die erstaunlichste dieser Reprisen findet sich im eröffnenden Adagio. Eine ungeordnete, rhetorisch elliptische Fortschreitung über einen Tritonus (von h zu f). Die Dominante C wird durch ihre Abwesenheit problematisiert, besonders dort, wo musikalische Struktur und Konvention sie erfordern würden. Und obwohl die Schlussklimax des Satzes dann völlig korrekt eine stark kadenzierende Dominante bringt, ist sie doch nur ein dissonanter Quartsextakkord; die nachfolgende Auflösung in die Schlusskadenz sinkt ins piano zurück, und die Stürme legen sich. Was auch immer Haydn damit ausdrücken wollte, die ganze Symphonie scheint im Schatten dieses außergewöhnlichen Satzes zu stehen — sie muss außermusikalische Assoziationen gehabt haben.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
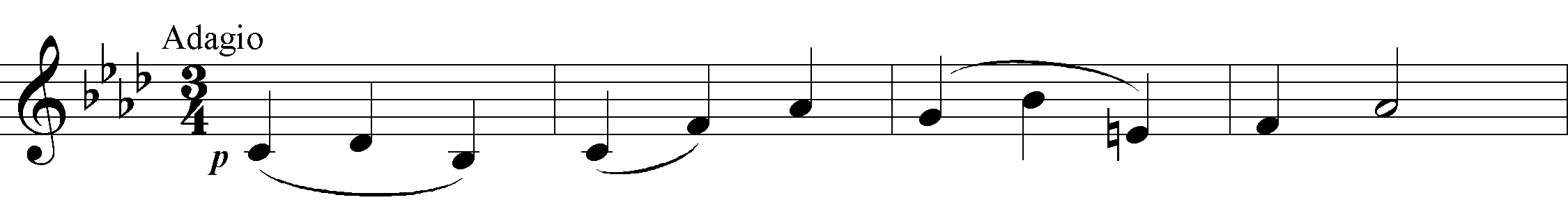
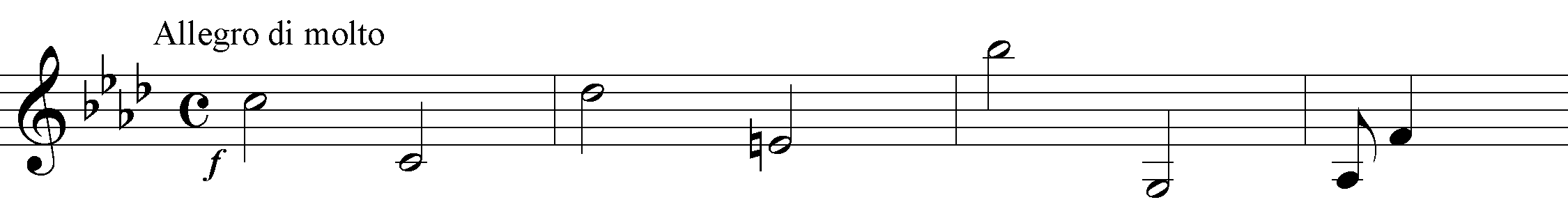
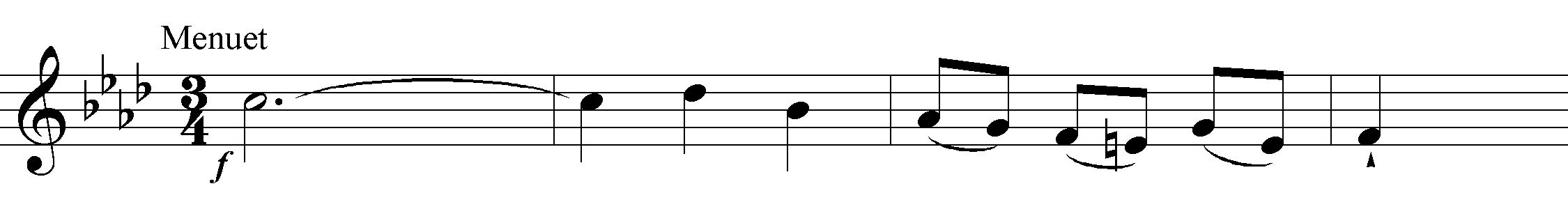
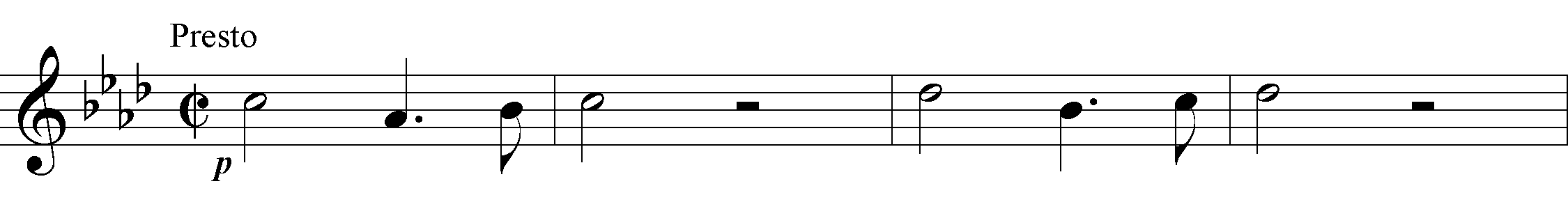
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)