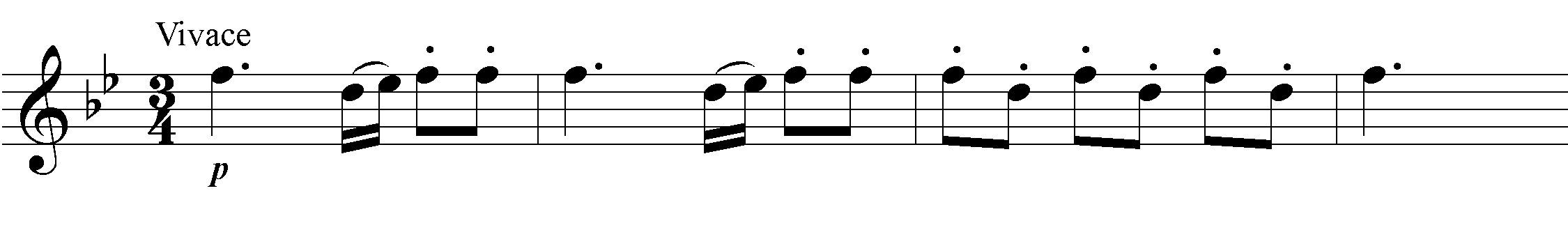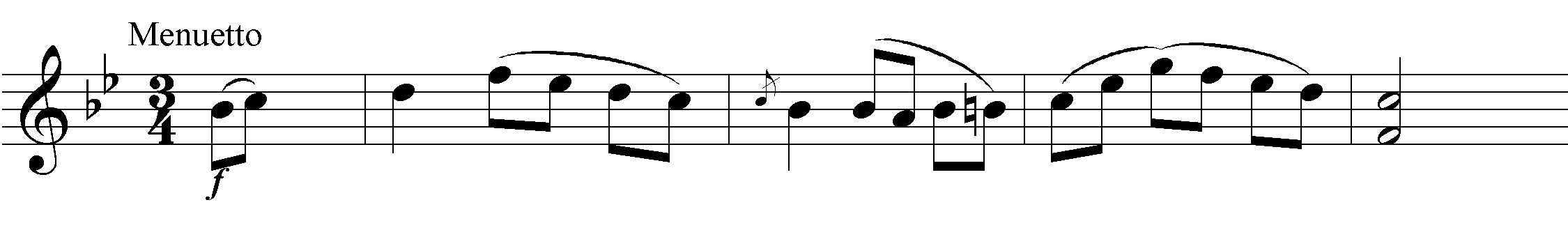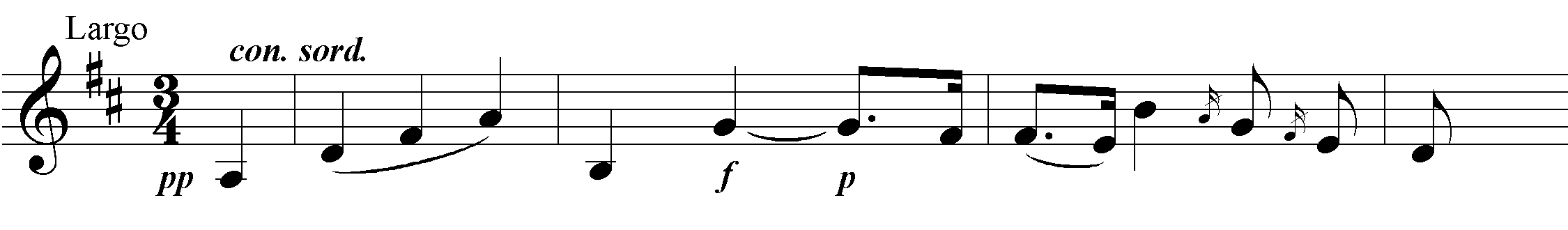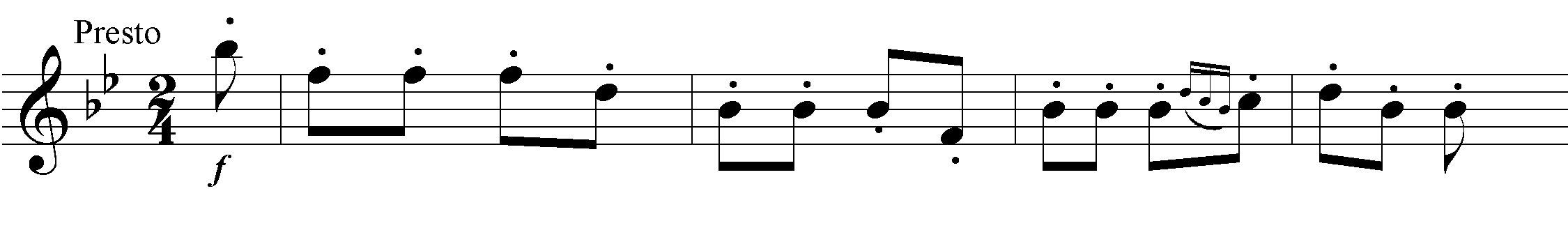68
B-Dur
Sinfonien um 1775/76
Herausgeber: Sonja Gerlach und Wolfgang Stockmeier; Reihe I, Band 8; G. Henle Verlag München
Hob.I:68 Symphonie in B-Dur
Der erste Satz, ein Vivace, beginnt mit einem ruhigen, fließenden 3/4-Thema, das voraussehbar später lebhafter wird und schließlich zu einem "zweiten Thema" führt, das, ohne laut zu lachen, grausam anzuhören wäre. Die Durchführung scheint ereignislos zu sein, bis Haydn, bevor wir dessen gewahr werden, durch einen tonalen Kunstgriff in die Reprise gleitet. Das Ende des Satzes weitet das tonal verschobene Schlussthema beträchtlich aus.
Zum letzten Mal in seinem sinfonischen Schaffen (die wenigen übrigen Beispiele sind alle viel früher) stellt Haydn das Menuett an die zweite und den langsamen Satz an die dritte Stelle. Ersteres nimmt, mit quadratischer Phrasenbildung und einfacher Satztechnik, ein rustikales Wesen an, während das Trio seine Subtilität, mit scherzhaften auftaktigen Phrasen, im Ärmel trägt, was auf das Trio der "Oxford" Symphonie hindeutet.
Das Adagio cantabile ist wohl der außergewöhnlichste Satz in dieser Folge, vor allem hinsichtlich der verwirrenden Affektmischungen. Das Anfangsthema und die Überleitung werden beinahe vollständig alleine von den mit Dämpfern versehenen Violinen gespielt; die Melodie in den ersten Violinen scheint willkürlich, repetierend und richtungslos zu sein. Unterdessen schreiten die zweiten Violinen in ununterbrochenen, beinahe mechanischen Sechzehnteln voran, scheinbar abgesondert von der grüblerischen darüberliegenden Melodie (viele werden mit Charles Rosen an die Symphonie "Die Uhr" erinnert sein) — abgesehen von gelegentlichen Forte-Einwürfen des vollen Orchesters auf demselben Sechzehntelmotiv, die jedoch niemals genau dann kommen, wenn sie es "sollten". Die Wirkung ist zugleich amüsant und verwirrend. Im weiteren Verlauf des Satzes wird die rigide Unterscheidung von Melodie und Begleitung komplexer, während der Ausdruck an Ernst zunimmt (obwohl zunächst nicht für allzu lange), bis in der stark modulierenden Durchführung jeder Humor zurückgelassen wird. Dennoch kehren alle diese Diskontinuitäten in der Reprise zurück. Der Satz ist in seiner Gesamtheit nicht leicht zu "durchschauen". Sind die komischen Elemente "theatralisch" oder von höherem Esprit, oder eine Art brechtscher Verfremdung? Fügen sich diese ungleichartigen Elemente zu einer zufriedenstellenden Einheit zusammen oder erfahren sie keine Integration?
Das Rondofinale, das der reinen Unterhaltung so nahe kommt wie sonst nie bei Haydn, wird nicht von solchen Schwierigkeiten der Interpretation überschattet. Das Hauptthema ist eine rauhe Dreiklangsgeschichte; auch nutzen die Episoden, trotz ihrer ansprechenden Mannigfaltigkeit, nicht die kühn modulierenden oder kontrapunktischen Passagen, die Haydn gewöhnlich in diesem Kontext bietet — auch wenn eine Reprise eine rohe kanonische Variante des Hauptthemas enthält. In der komischen Coda wird alles übermäßig wiederholt (dies ist keine Kritik): ein hoher dominantischer Orgelpunkt verhallt; der Reihe nach in allen Instrumenten "Echosolo"-Ein-sätze auf dem Hauptmotiv, die diese Dominante geistreich auflösen; ein Tremoloaufgang und insgesamt "zu viele" jauchzende Akkorde am Ende.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
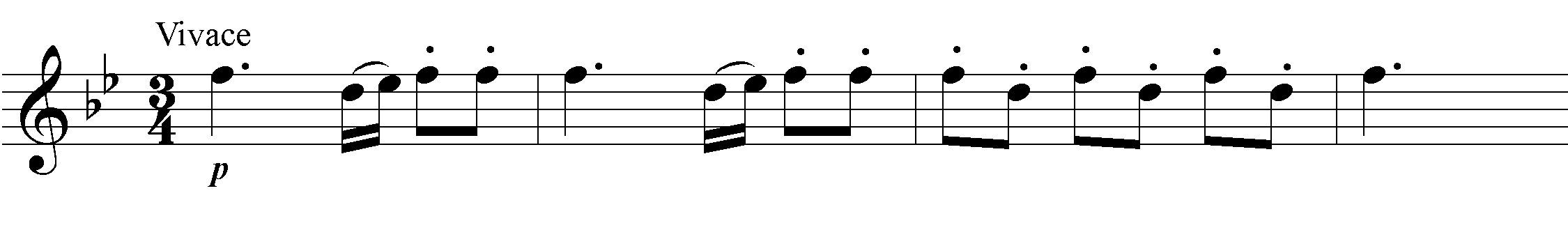
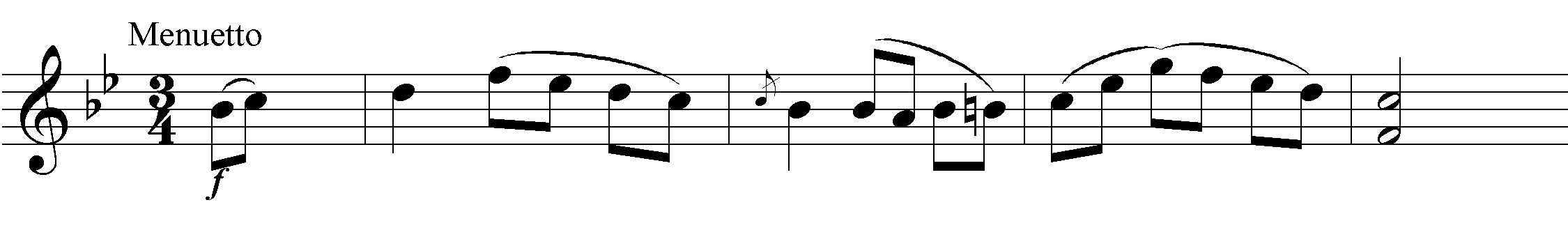
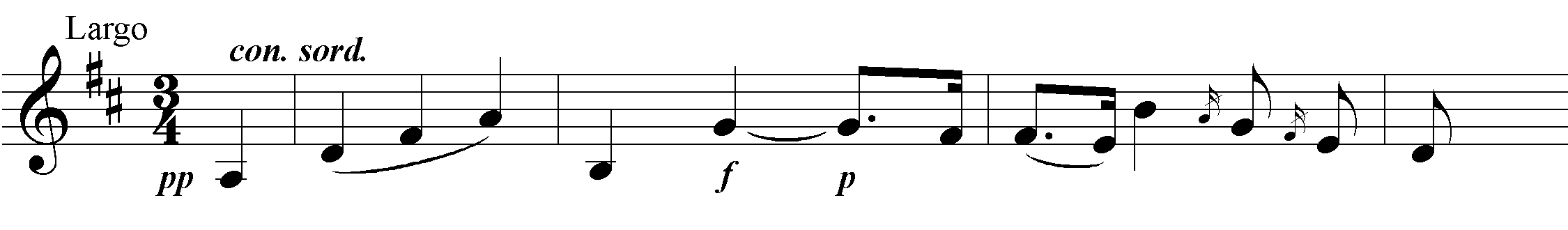
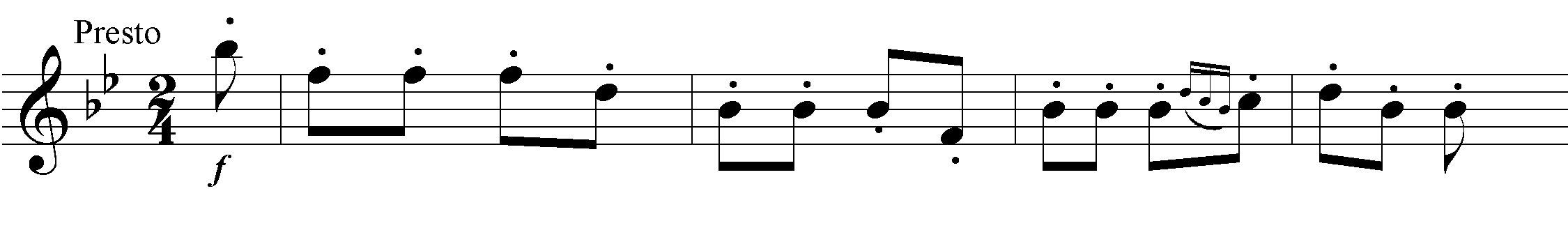
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)