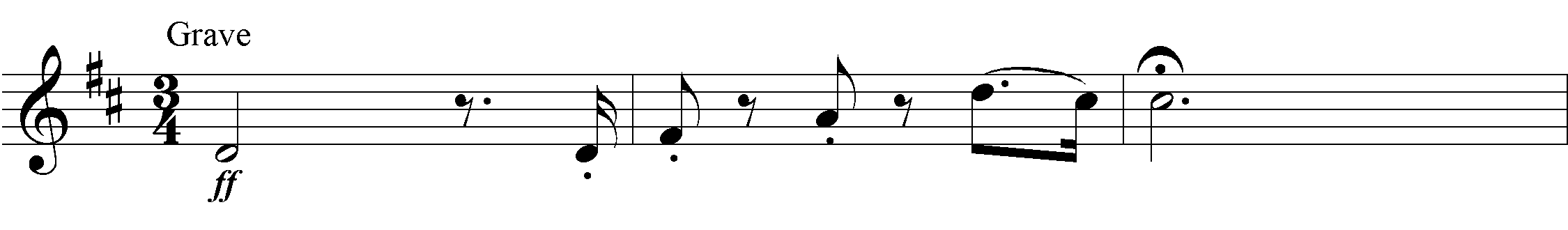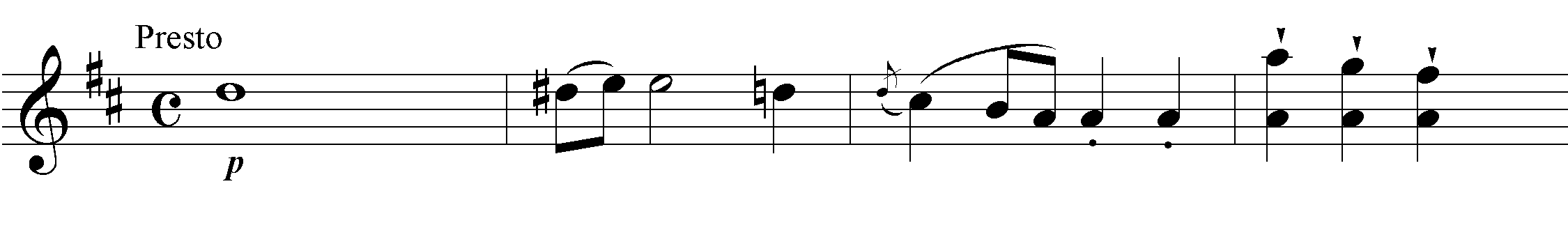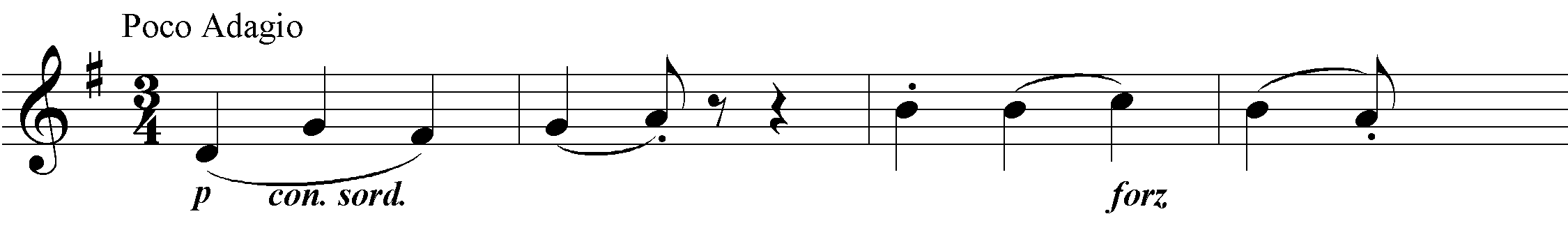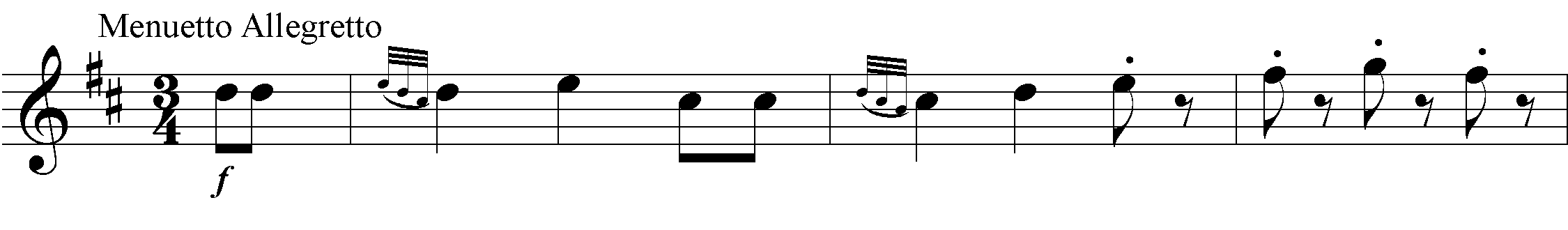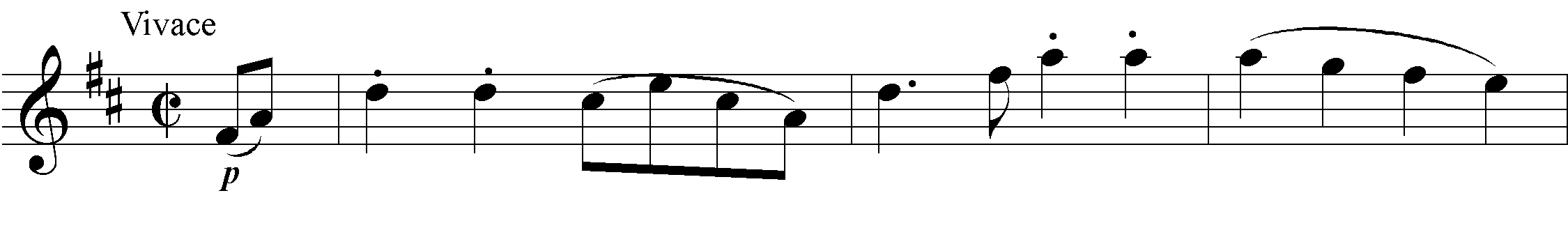75
D-Dur
Sinfonien um 1777-1779
Herausgeber: Sonja Gerlach und Stephen C. Fisher; Reihe I, Band 9; G. Henle Verlag München
Hob.I:75 Symphonie in D-Dur
Die langsame Einleitung ist mit "grave" bezeichnet (dies ist das einzige Instrumentalwerk Haydns, in dem dies so ist; gewöhnlich schreibt er "adagio", gelegentlich "largo"). Sie ist tatsächlich von ernstem Charakter und kommt in Form und Stimmung seinen späten "Londoner" Einleitungen näher als irgendeiner anderen in dieser Folge. Es alternieren Fortissimo-Attacken, die im Einklang stehen, mit Seufzermotiven im Piano; dann geht die Einleitung nach Moll und gelangt schließlich zu einem ausgedehnten Orgelpunkt auf der Dominante, wobei weitere chromatische Einfärbungen eingeflochten sind. Das Presto im 4/4-Takt (eine weitere unübliche Kombination) beginnt ruhig, jedoch atemlos mit dem chromatischen Aufschwung, D-Dis-E, den mehr als ein Kommentator als eine Vorahnung des Allegro aus der Ouvertüre zu Don Giovanni gehört hat (Mozart hat einmal Haydns Thema abgeschrieben). Die Exposition ist relativ knapp gehalten und behält beinahe durchgehend die atemlose Atmosphäre bei; das ein wenig synkopierte zweite Thema bricht ab, kaum dass es begonnen hat. Die Durchführung beginnt geruhsamer und bringt sequenzierende und kontrapunktische Verarbeitungen des Hauptthemas; sie geht dem zentralen Abschnitt in dem vorherrschenden "vorwärts treibenden" Stil voran. Die Rückführung kehrt jedoch zu der geruhsamen kontrapunktischen Stimmung und Satztechnik zurück; dies ist die kompositorisch komplexeste Passage des Satzes, auf die Haydn wiederum innerhalb der Reprise verweist. Damit gibt sich das Thema als eine komplexe Persönlichkeit zu erkennen: Es ist nicht nur geschäftig und vorwärts treibend, sondern auch kontrapunktisch angelegt und tief empfunden.
Das Poco Adagio ist das erste, aus dem ein bestimmter "Typus" innerhalb der langsamen Sätze Haydns entstand: Es ist beherrscht von einer wunderbaren, hymnenartigen Melodie im 3/4-Takt mit regelmäßigen sangbaren Legato-Phrasen (vgl. auch z. B. die Symphonien 87, 98 und 99). Die Form besteht aus einem gleichmäßig gestalteten Thema und Variationen; die vier Variationen, die aus sich regelmäßig beschleunigenden Notenwerten bestehen, bringen nacheinander die ersten Violinen und Bläser über einem rhythmischen Ostinato, ein Solocello und die zweiten Violinen unter einer "direkten" Vorstellung der Melodie (mit einer hinreißenden Bläserbegleitung); es folgt eine sehr kurze Coda, die wie die letzte Variation gestaltet ist.
Das Menuett mit seinem energischen "Drehmotiv" kehrt zu dem vorwärts treibenden Stil des Presto zurück; im Trio sind die Flöte und die ersten Violinen sich verdoppelnd im Einklang geführt (die Verdopplung in der Oktav war üblicher) und spielen eine schwungvolle Melodie mit auftaktigen Forzato-Akzenten. Das Finale, ein Vivace alla breve, ist ein freies Rondo in der Form A-B-A1-C-A2-Coda. Das Hauptthema, das die Streicher allein spielen, besteht aus einer "gerundeten binären" Form, a|b—a, wobei beide Hälften wiederholt werden; A1 weist eine viel abwechslungsreichere Besetzung auf, während in A2 der b-Abschnitt erweitert und mit "Überraschungen" nach Art Haydns angefüllt ist. Zuvor steht B in der Molltonika und bringt eine in den Bass versetzte Variante des Themas; C, das auf eine kontrapunktische Überleitung folgt, die dem Schluß von A1 entnommen ist, beginnt in dem parallelen h-Moll, kehrt jedoch bald in die Dominante der Haupttonart zurück und geht zu A2. Nach letzterem Formteil werden in einer ausgedehnten Coda sowohl die kontrapunktische Überleitung zu C und die Überraschungen von b weiterentwickelt. Daran angefügt ist eine grüblerische Kadenz mit "langen Noten" — eine Erinnerung an die Stimmung des Poco Adagio? — vor den abschließenden Ausrufen.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
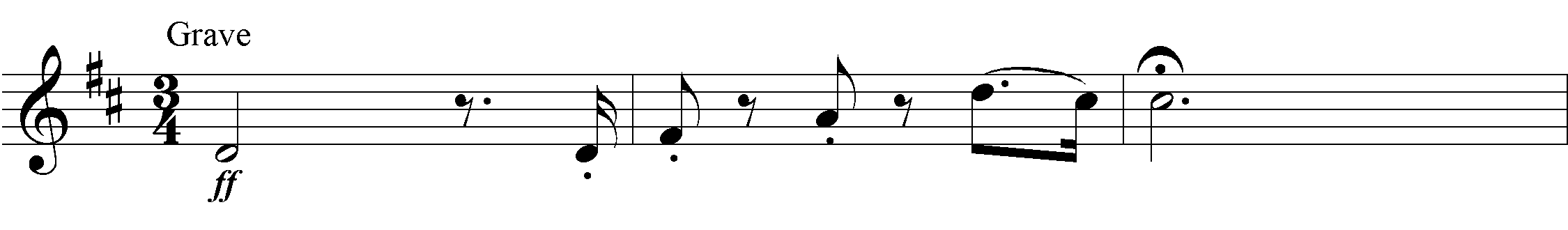
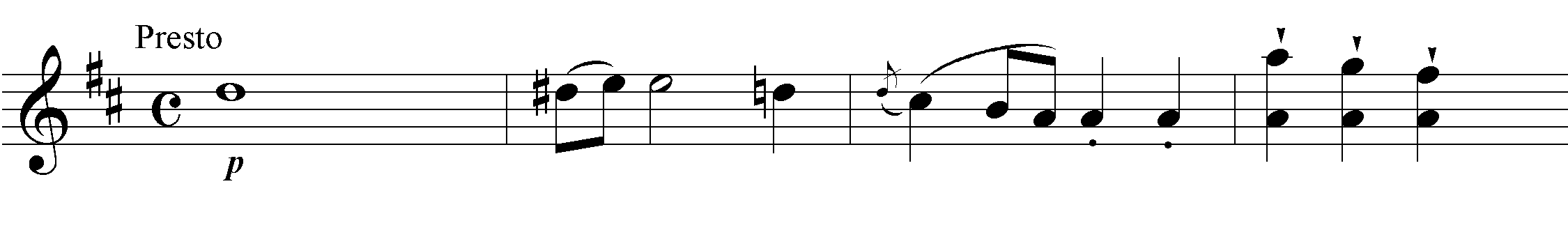
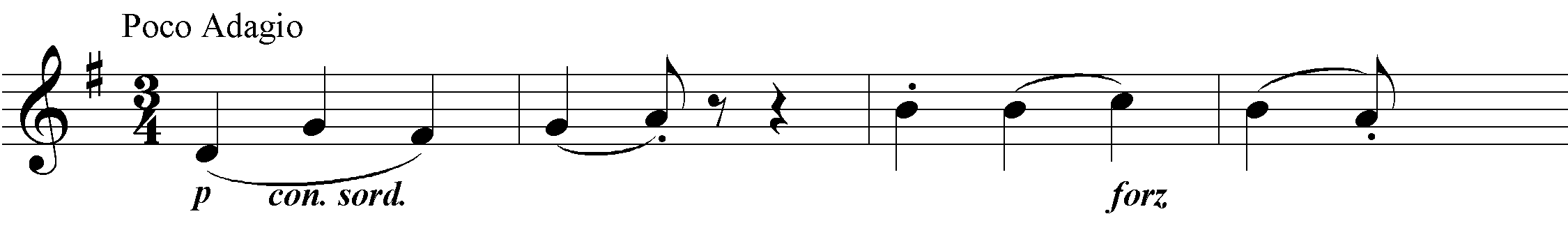
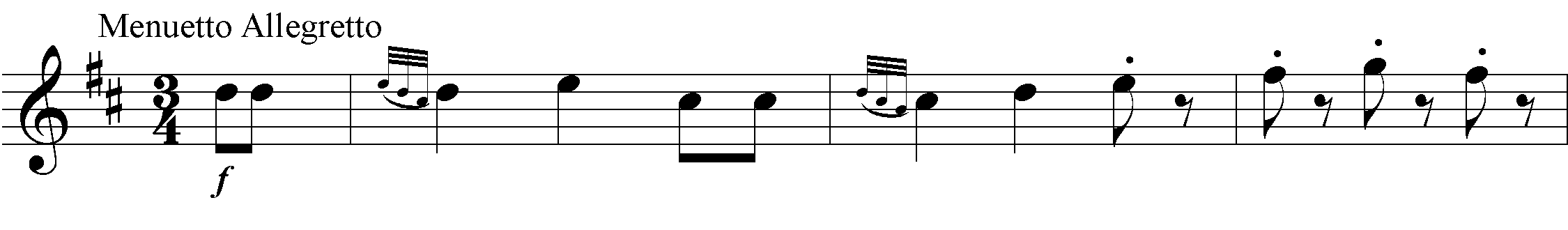
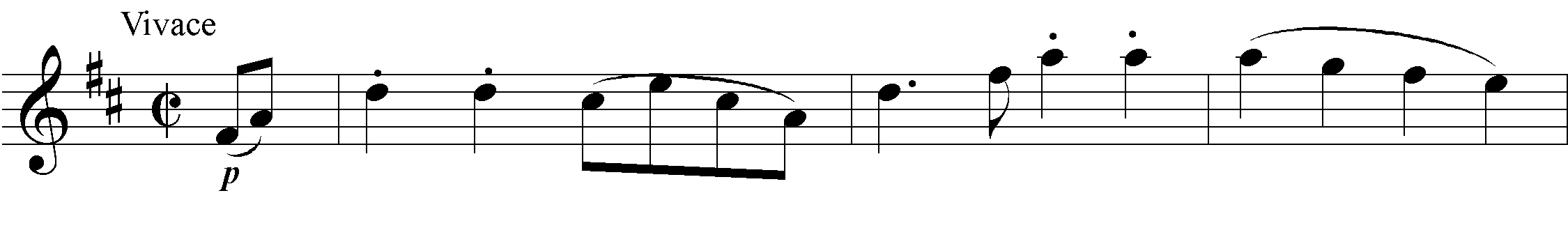
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)