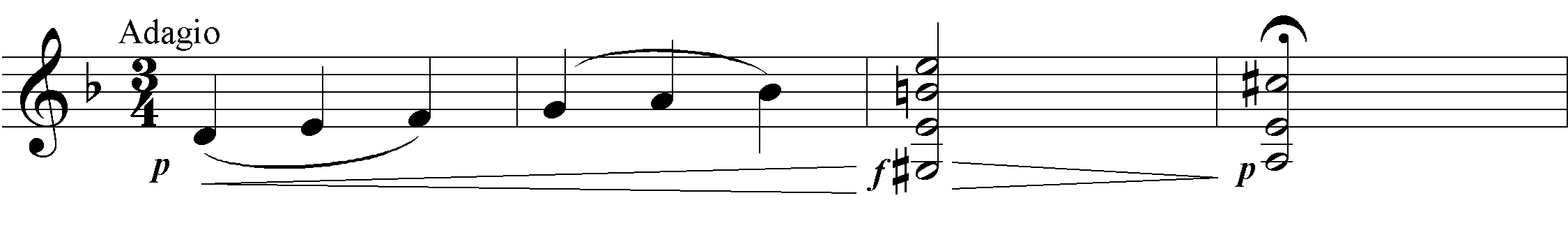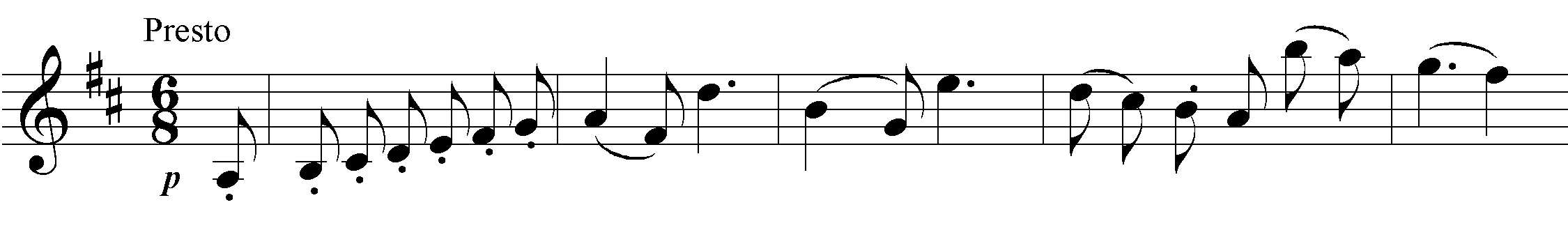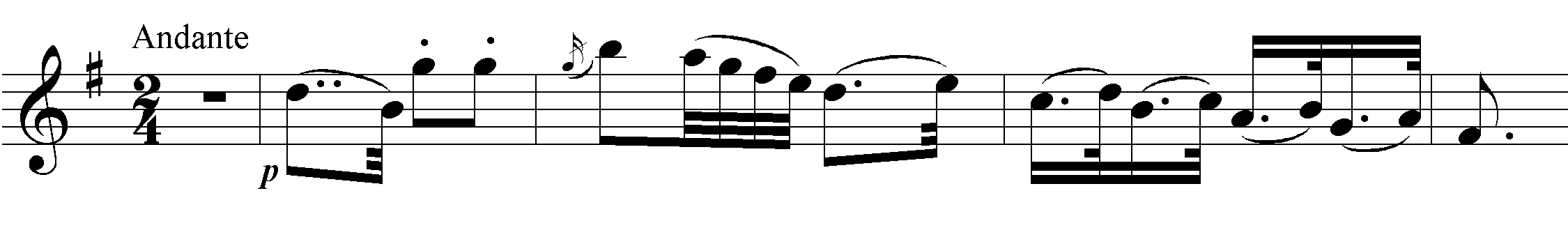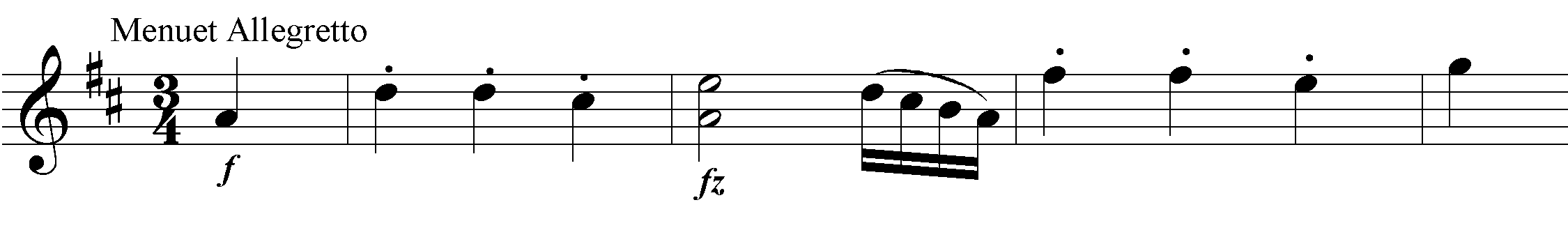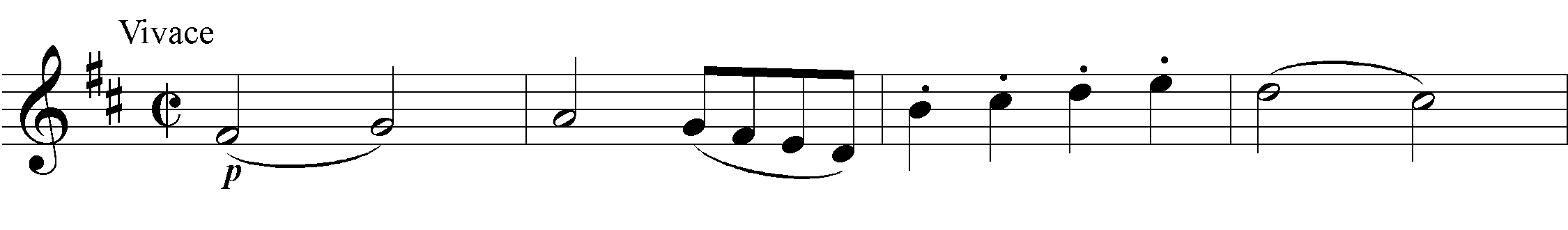101
"Die Uhr"
D-Dur
Londoner Sinfonien, 3. Folge
Herausgeber: Horst Walter; Reihe I, Band 17; G. Henle Verlag München
Hob.I:101 Symphonie in D-Dur
Die Symphonie Nr. 101, “Die Uhr”, gehört zu Joseph Haydns meistgespielten und populärsten Werken. Sie wurde während der Konzertsaison 1794 erstmals aufgeführt.
Der erste Satz ist - nach einer mysteriösen d-moll-Einleitung, die bereits die Bewegungsrichtung des Hauptthemas vorwegnimmt - ein leichtgewichtiges Presto im Sechsachteltakt. Das Seitenthema erweist sich eher als Variante denn als Kontrast; die Durchführung ist überraschend kontrapunktisch.
Das Stück hat seinen Beinamen von der “tickenden”, der Bewegung eines Metronoms gleichenden Ostinatobegleitung der Fagotte und Streicherpizzicati im zweiten Satz, einer groß angelegten Liedform mit variativen Elementen. Das Menuett ist den Flötenuhr-Stücken von 1793 entlehnt; der dissonante Beginn scheint sich einem musikalischen Spaß des Komponisten zu verdanken: wie Musikanten, die bei der Begleitung den Harmoniewechsel “verschlafen” (auch Beethoven arbeitet viel später in der Dorfmusikantenszene des Scherzos seiner “Pastorale” mit ähnlichen Effekten).
Das Finale ist ein äußerst kunstvolles Sonatenrondo, dessen Durchführungsteile mit Fugati durchsetzt sind; man kann dieses Finale ohne Übertreibung als einen der Gipfel von Haydns kompositorischer Kunst bezeichnen, die in diesem Falle weniger in der bewiesenen “Gelehrsamkeit”, sondern in der Selbstverständlichkeit besteht, mit der sich das “Gelehrte” einem Presto-Finale einfügt.
Die Symphonie Nr. 101 komponierte Haydn im Rahmen seiner zweiten Englandreise. Sie ist in zwei Etappen entstanden: der zweite bis vierte Satz noch in Wien, der erste Satz in England. Die Uraufführung fand am 3. März 1794 statt.
Der Morning Chronicle berichtet nach der Uraufführung: „Nichts könnte origineller sein als das Thema des ersten Satzes; und hat er einmal ein treffliches Thema gefunden, kann niemand besser als Haydn unaufhörliche Mannigfaltigkeit daraus schöpfen, ohne auch nur einmal davon abzulassen. Die Gestaltung der Begleitung im Andante, obgleich höchst schlicht, war meisterhaft, und wir hörten nie zuvor einen reizvolleren Effekt als den des Trio im Menuett. – Es war Haydn, was könnte man, was bräuchte man mehr zu sagen?“
Der Beiname „Die Uhr“ stammt vom Wiener Verleger Johann Traeg, der 1798 eine Klavierfassung des Andante als „Rondo. Die Uhr“ herausbrachte. Teilweise können solche Beinamen jedoch auch eine zu hohe Erwartungshaltung hervorrufen. So berichtet Jacob (1952) über einen Vorfall nach der Aufführung der Symphonie im Jahr 1928 in Wien durch den italienischen Dirigenten Arturo Toscanini: Einer der Hörer beschwerte sich im Künstlerzimmer, er habe die Uhr nicht bzw. nur im Andante ticken hören. Er habe erwartet, ein Tongemälde mit einem durchgehenden, auf eine Uhr bezogenen Thema zu hören, also etwa eine „Geschichte der Uhr“, und fühlte sich sehr enttäuscht.
Analyse

Analyse der Sätze
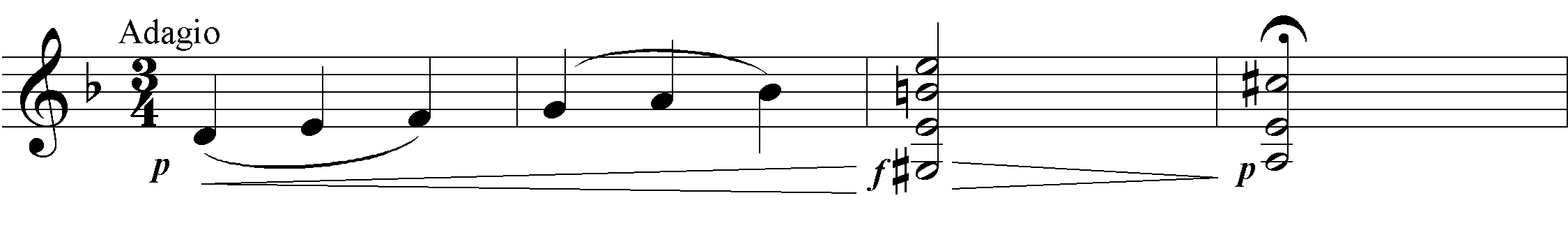
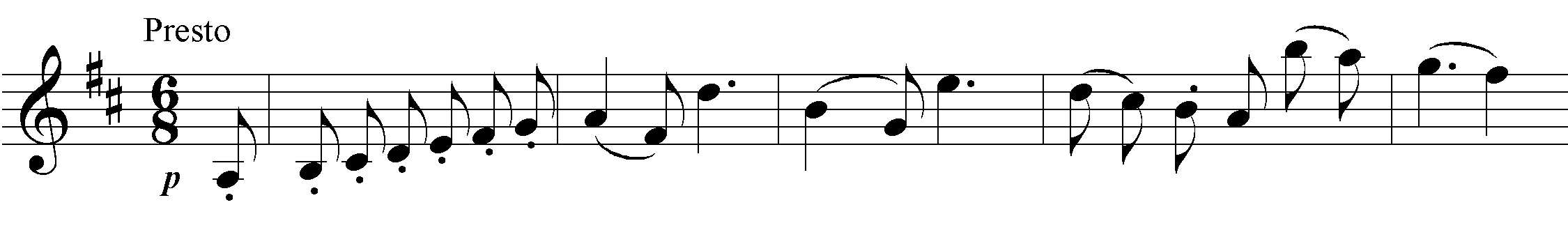
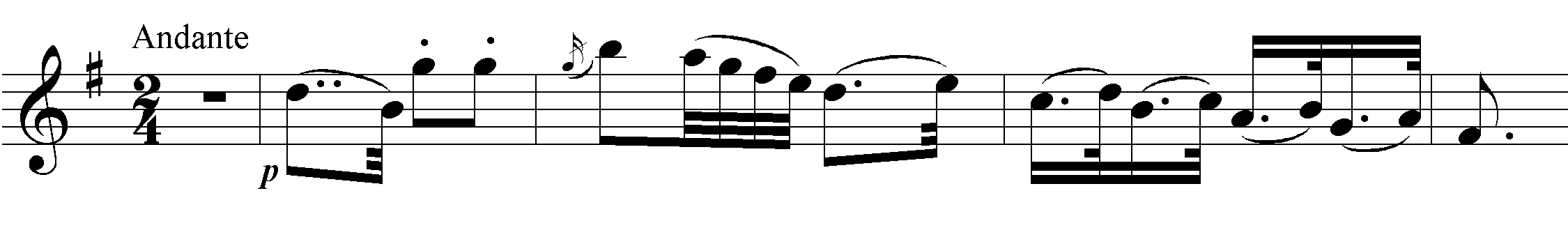
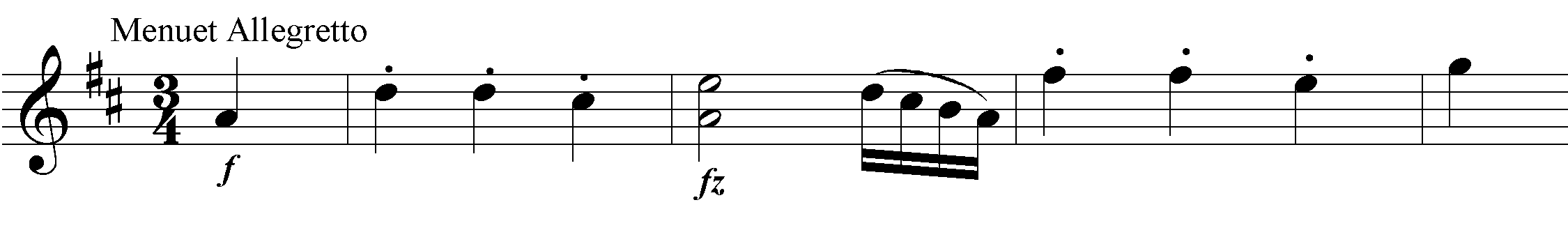
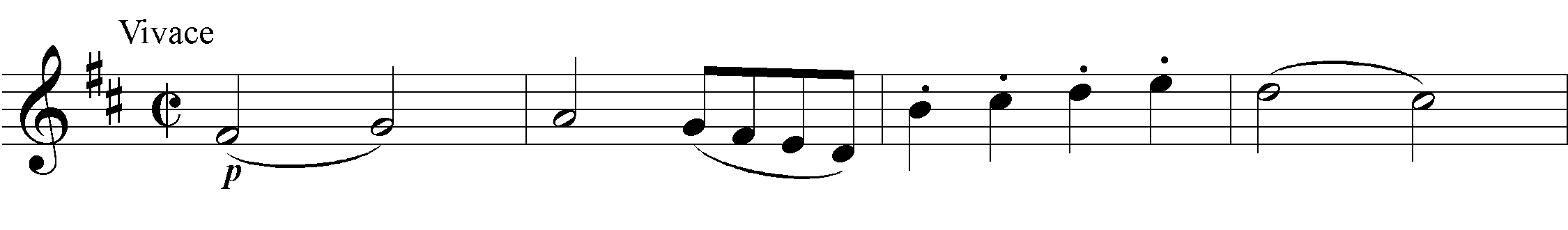
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)