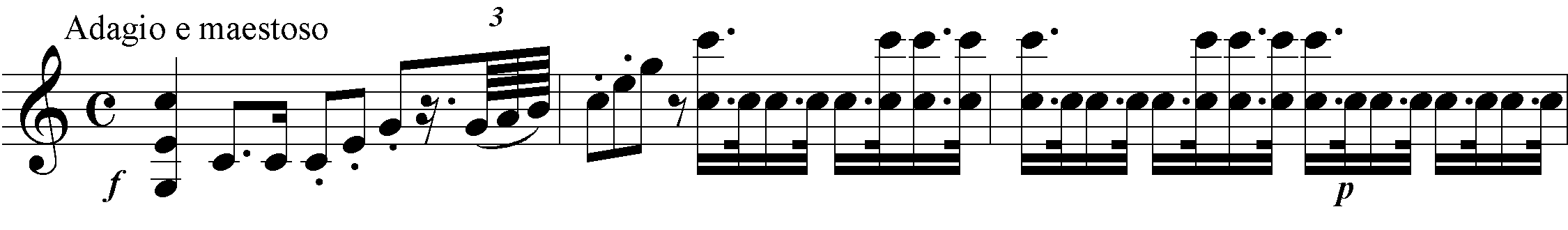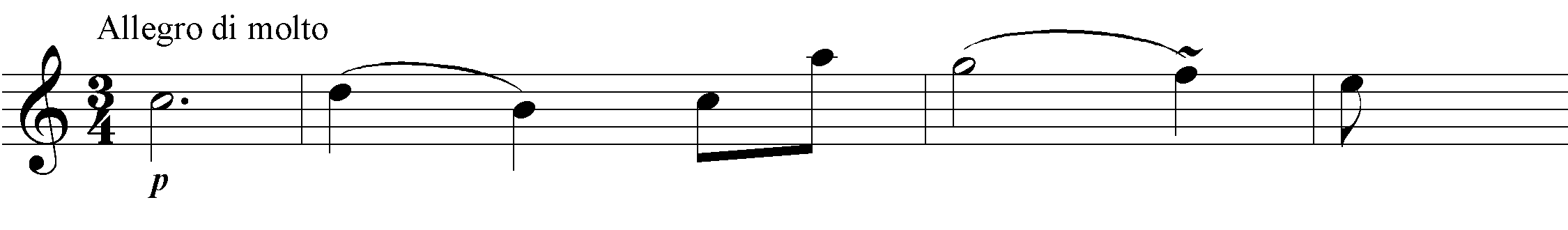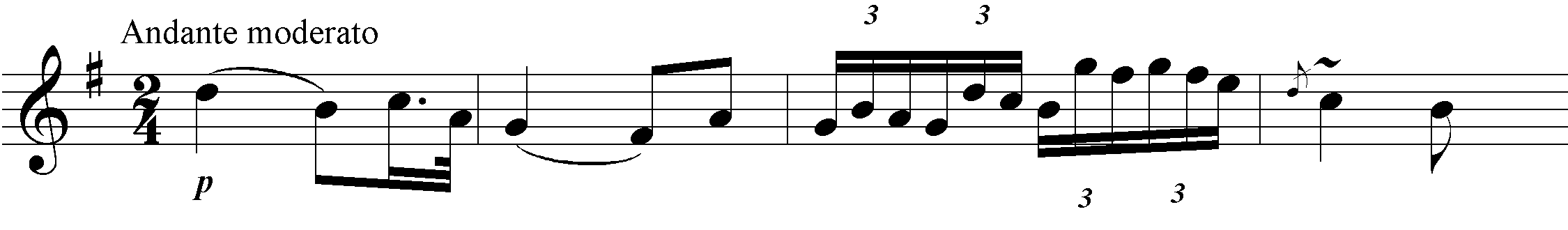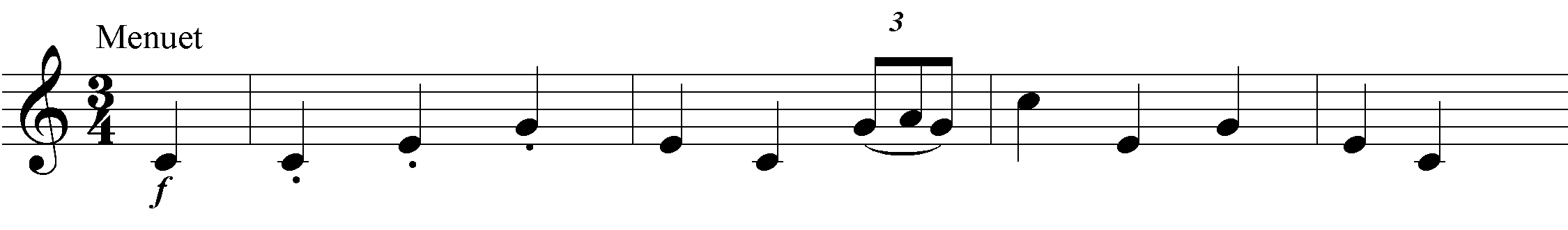50
C-Dur
Sinfonien 1773 und 1774
Herausgeber: Wolfgang Stockmeier; Reihe I, Band 7; G. Henle Verlag München
Hob.I:50 Symphonie in C-Dur
Diese Symphonie verrät ihre Ursprünge als Ouvertüre zu dem Götterrat in mehrerer Hinsicht. Die langsame Einleitung, die man vor ca. 1780 nur selten findet, vermittelt die den Göttern und Göttinnen angemessene, majestätische Atmosphäre; ihr Bühnenauftritt hätte gleich nach diesem Prolog stattgefunden. Das darauf folgende Allegro di molto ist knapper gehalten als die ersten Sätze der Symphonien Nr. 54—57: Die Modulationen sind abrupt, und der Achteltakt ist unnachgiebig, lässt nicht einmal im "zweiten Thema" gegen Ende der Exposition, das mit bloßen sechs Takten kaum ernst zu nehmen ist, nach. Alles drängt auf das kommende Drama hin — wobei in der sinfonischen Form das Drama freilich aus dieser Energie entsteht.
Das Andante moderato ist in der "heiteren" G-Dur-Dominante statt der üblicheren Subdominante gehalten (obwohl Haydn sich im Vergleich zu seinen Zeitgenossen bei langsamen Sätzen öfter für die Dominante entschied). Seine ursprüngliche Funktion als Opernsatz mag die konservative Orchestrierung erklären, die im Prinzip lediglich Streicher vorsieht — mit einem Solocello, das in der unteren Oktave die Melodie verdoppelt. Außerdem weist dieser Satz keinen echten Durchführungsteil, sondern nur eine sechs Takte lange Wiederaufnahme auf, die wiederum in konservativer Weise vor der Reprise den Grundton erneut aufgreift. Andererseits setzen bei der Reprise die Oboen plötzlich ein und vertiefen den Ausdruck; diese unerwartete Bereicherung der Instrumentenpalette tritt in der "Sturm- und Drangzeit" Haydns bei den langsamen Sätzen häufig auf.
Das neu komponierte Menuett ist im Gegensatz dazu sehr lang (das gilt auch für die meisten anderen Menuette in diesem Volumen). In der Tat handelt es sich dabei um eine Miniversion der Sonatenform: Hauptthema von den Trompeten, lebhafter Übergang, Schlussthema piano in der Dominante; mittlerer Teil vorwiegend in Moll mit einer imitatorischen, dissonanten Abwandlung des Schlussthemas; und eine volle Reprise. Doch die eigentliche Überraschung liegt im Trio: Es ist voll durchkomponiert und damit einzigartig in den Symphonien Haydns. Es beginnt mit dem Kopfmotiv des Menuetts, immer noch in C-Dur, weicht aber plötzlich auf die Subdominante F-Dur aus, wobei die Trio-Melodie von der Oboe und den Geigen vorgestellt wird. Die Melodie ist sowohl melodisch als auch vom Rhythmus her ungewöhnlich (sechs Takte mit einem seltsam redundanten und instabilen harmonischen Rhythmus); die Entwicklung über vier Vorstellungen zu einer vollen Doppelperiode unterstreicht noch das Außergewöhnliche daran. Als schließlich eine Modulationssequenz einsetzt, klingt sie wie der Anfang des zweiten Teils einer konventionellen zweiteiligen Form; dieser Teil wechselt jedoch bald zu E-Dur, der Dominante von a-Moll (94. Takt). Erstaunlicherweise handelt es sich hier um die Rückführung zum Menuett, das direkt über eine entferntere Sequenz einsetzt (III#-I); dem liegt die enharmonische Umdeutung eines gemeinsamen Tons zugrunde (fünftes Stufe von a-Moll = dritte Stufe von C-Dur). Insgesamt ist das Trio also als instabiler, modulierender Übergang vom Anfang des Menuetts mit Rückführung zu sich selbst strukturiert. (Ein "normales" Trio in der gleichen Tonart und mit gleicher Instrumentierung findet sich in der Symphonie Nr. 56.)
Das geistreiche und lebhafte Presto-Finale quillt über vor dynamischen Kontrasten und greift den knappen Stil des ersten Satzes wieder auf. Die Exposition umfasst nur zwei Abschnitte; beide beginnen mit dem leisen Hauptthema in zweiteiligem Kontrapunkt (ein ferner Vorläufer des Finales der Symphonie Nr. 95, ebenfalls in C-Dur), während die Zäsur zwischen den beiden durch einen vierfachen, lauten, dissonanten Akkord markiert wird. Die Durchführung erreicht mit zwei längeren, lauten Akkordpassagen mit schnellem Wechsel zwischen Streichern und Bläsern ihren Höhepunkt; bei der zweiten treten fürchterliche Dissonanzen zwischen den Bläsern (auf E) und den Streichern auf. Aber bei diesem E handelt es sich um die Dominante von a-Moll — und ebenso wie beim Trio setzt die Reprise piano ein, ohne Übergang, mit dem gemeinsamen Ton E. Das Ende geht nahtlos in eine kurze, aber großartige Koda über.
Menuett und Finale in C-Dur
Diese beiden Sätze sind in einem unvollständigen, undatierten Originalmanuskript erhalten, das sich heute in Berlin befindet. Haydn komponierte sie anscheinend 1773—74, um die aus zwei Sätzen bestehende Ouvertüre zu L'infedeltà delusa (Hob. 1a: 1) auf eine Symphonie mit vier Sätzen zu erweitern (man weiß sicher, dass Nr. 50 auf diese Weise entstand). Ja, zwei Quellen, die er nach Spanien verkaufte, überliefern tatsächlich eine solche Symphonie. Später trennte er diese Teile jedoch wieder heraus, verkaufte die Ouvertüre an Artaria, wo sie 1782 als Teil einer Serie von sechs Ouvertüren veröffentlicht wurde. Das Finale (nicht aber das Menuett) fand vorübergehend Verwendung in einer vorläufigen Fassung der Symphonie Nr. 63, wurde jedoch mehr oder weniger umgehend durch das endgültige Finale ersetzt (vgl. Folge 10). Die Kombination von Ouvertüre und Menuett + Finale zur Symphonie erwies sich als nicht von langer Dauer, und Musikwissenschaftler wie Interpreten sehen diese beiden Sätze weiterhin als Fragment an. Stilistisch sind sie mit den entsprechenden Sätzen der Symphonie Nr. 50 eng verwandt; beide dürfen als hervorragende Beispiele der "C-Dur-Stimmung" Haydns Anfang der 70er Jahre gelten. Das Menuett geht mit scheinbar konventionellem Material aufwendig um und lässt beide Teile mit einem munteren, fröhlichen Motiv enden, während das Trio durch die vielen verschiedenen Harmonisationen eines einfachen Zweitaktmotivs sowie einen völlig unerwarteten Wechsel zu Moll am Schluss überrascht. Beim Prestissimo-Finale handelt es sich um einen kompakten, dynamischen Satz mit laufenden Achtelnoten. Ganz am Anfang wechseln sich ein Motiv mit drei "Hammerschlägen", ein einfaches, sechs Noten umfassendes, aufwärtstrebendes Tonleitermotiv und ein eher cantabile wirkendes Thema ab. Praktisch der gesamte Satz wird aus diesen drei Fragmenten aufgebaut. Besonders einfallsreich ist die Entwicklung, bei der Haydn alle möglichen überraschenden harmonischen Effekte für die Hammerschläge entdeckt, die nun regelmäßig mit den anderen Ideen alternieren.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
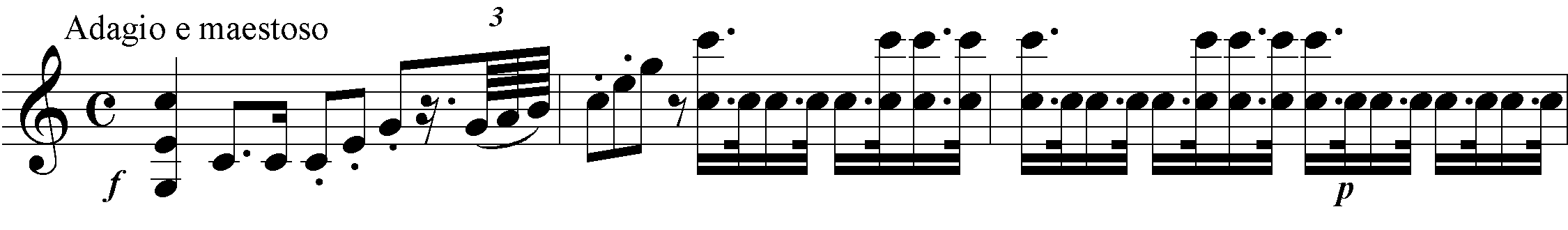
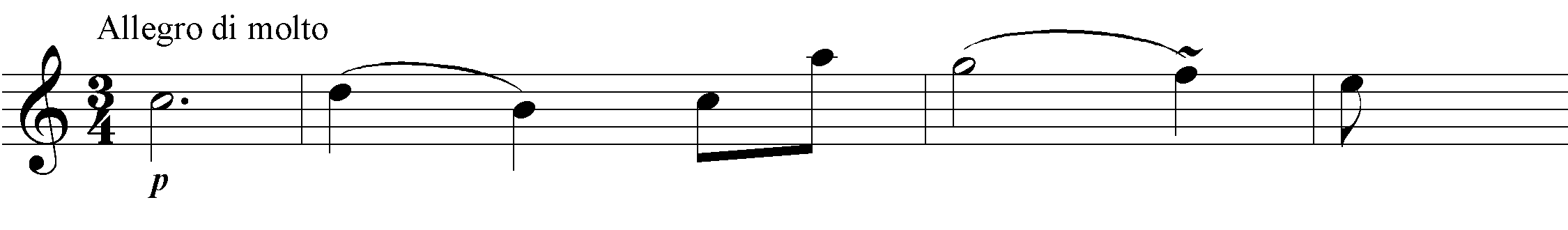
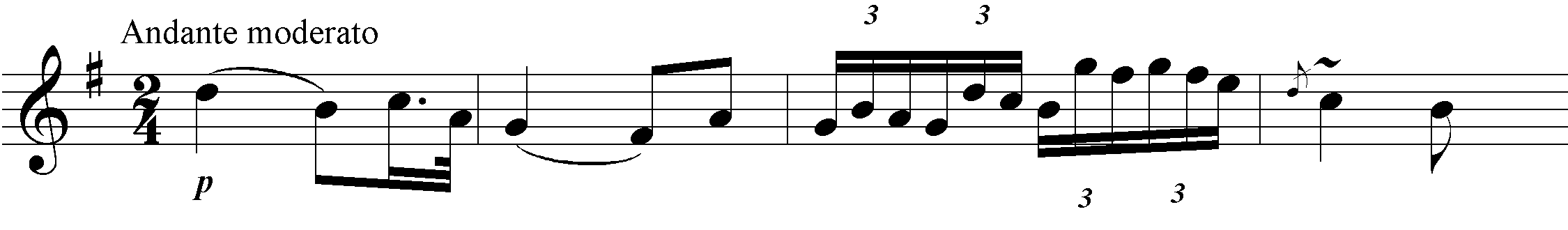
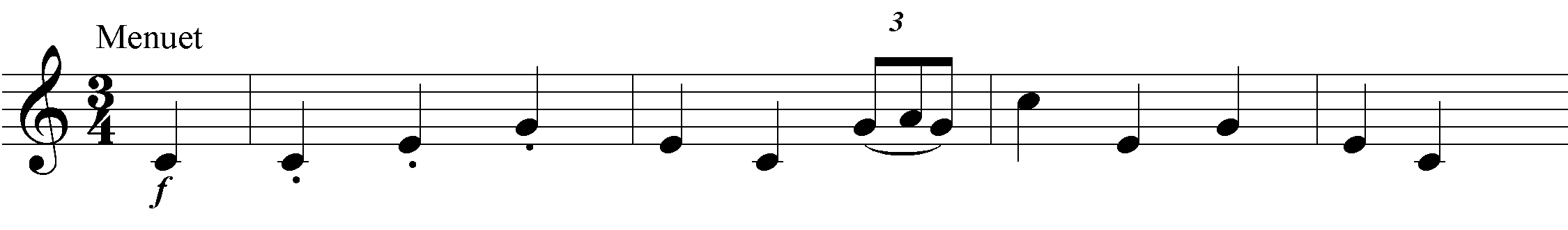

Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)