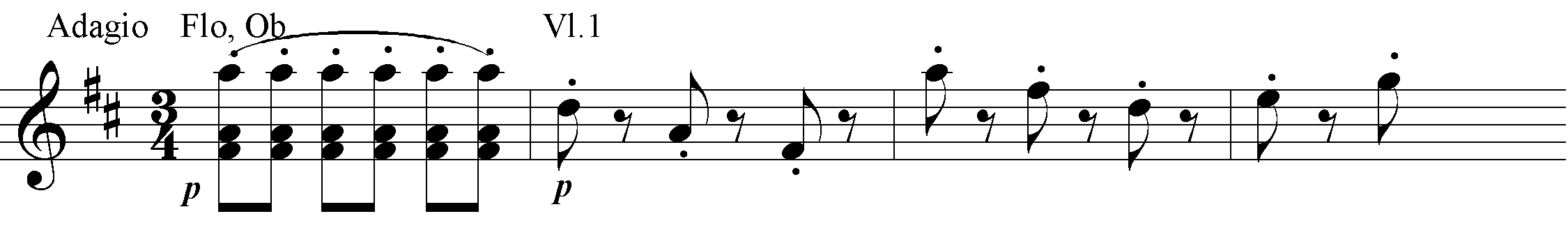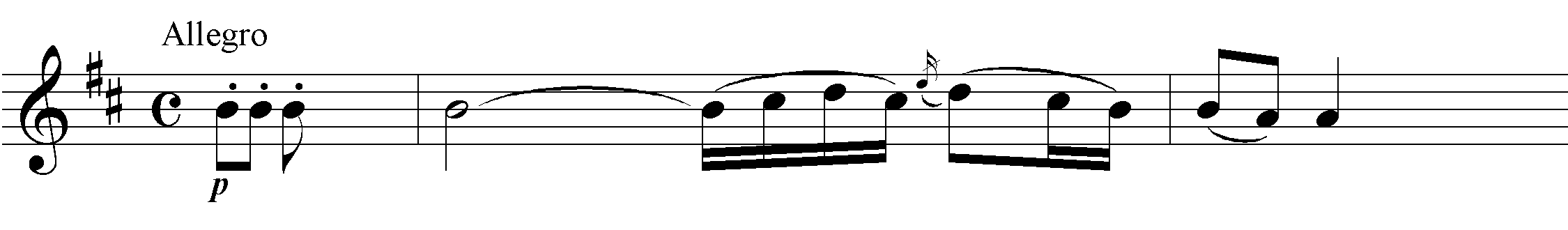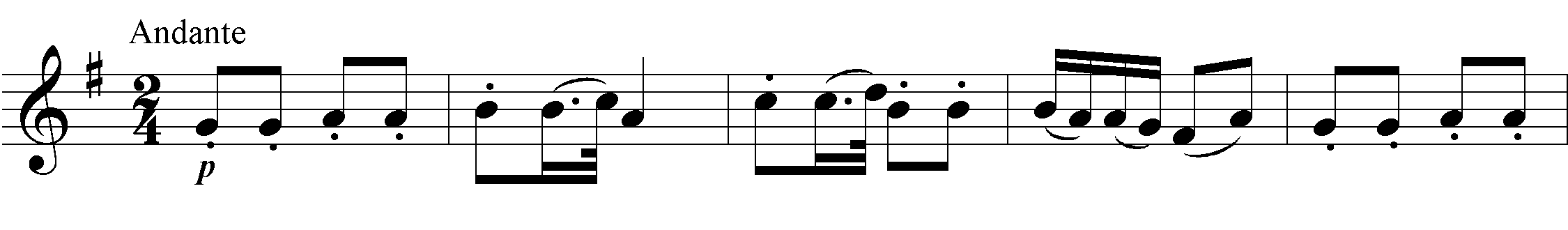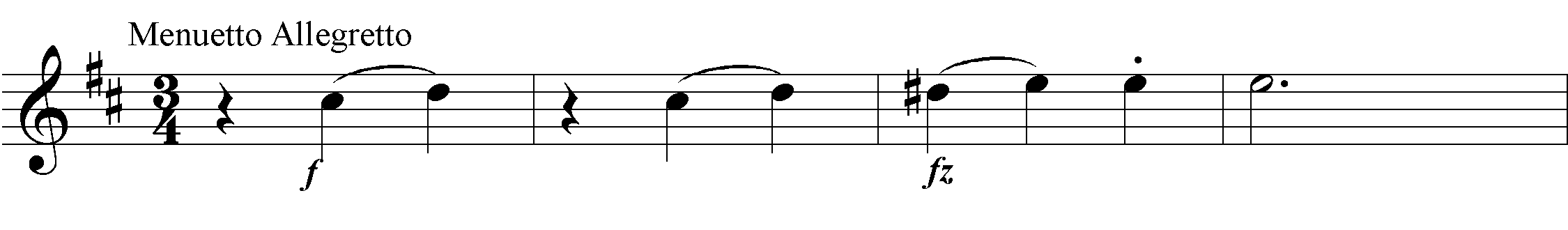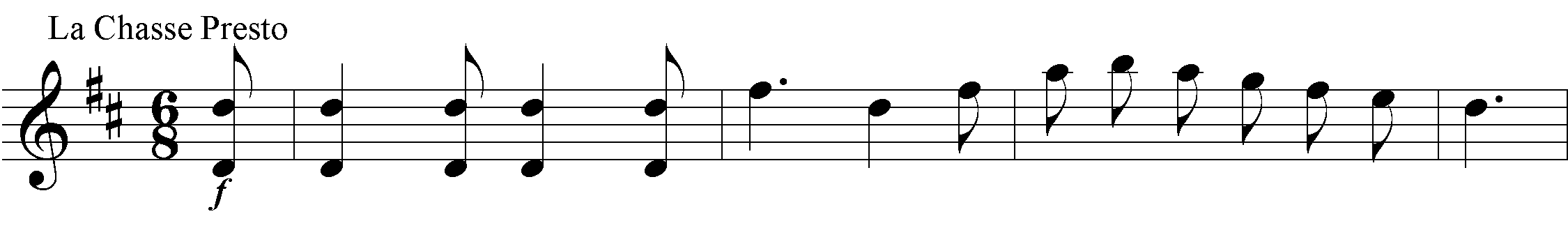73
"La chasse"
D-Dur
Sinfonien um 1780/81
Herausgeber: Heide Volckmar-Waschk und Stephen C. Fisher; Reihe I, Band 10; G. Henle Verlag München
Hob.I:73 Symphonie in D-Dur ("La Chasse")
Dieses Werk, das von den in dieser Folge enthaltenen Symphonien das zuletzt entstandene ist, weist die größte Ähnlichkeit mit den ab 1782 komponierten, vertrauteren Werken Haydns auf. In der massiven langsamen Einleitung fuhren die Achtel-Akkordwiederholungen der Bläsergruppe, welche die sich langsam bewegende Anfangsidee begleiten, schließlich zu dem diskreten auf-/abtaktigen Motiv aus vier Noten, das sich in der abschließenden dominantischen Ostinatofigur "durchsetzt", die zuerst im Fortissimo und dann im Piano vorgetragen wird. Das Hauptthema des Allegro beginnt mit demselben (identischen) Motiv und wird von einer auftaktigen Variante der ursprünglichen Achtel der Bläser begleitet. In einer intensiv durchdachten thematischen Arbeit, in der Art des zeitgleich entstandenen Streichquartetts, op. 33, dominieren diese verwandten Motive den ganzen Satz, der sich, bis zur "Oxford-Symphonie" von 1789, auf diese Art organischer aus seiner Einleitung entwickelt als irgendein anderer Satz bei Haydn. Das Allegro-Thema beginnt jedoch zurückhaltend: von der Subdominante ausgehend, gelangt es erst in seinem vierten Takt zur Tonika; die Violinen spielen es allein, und das volle Orchester setzt nicht vor der Beantwortung ein. Dies hat eine strukturelle Dynamik zum Ergebnis: die anfängliche Instabilität "treibt" die Musik vorwärts, und wenn das volle Orchester in der Tonika spielt, befinden wir uns bereits in der Überleitung zur zweiten Gruppe — und so weiter. Dies setzt sich durchgängig fort, am deutlichsten in der Durchführung, wo die unnachahmlichen Pausen Haydns sich mit bemerkenswerten harmonischen Wiederaufnahmen des auftaktigen Motivs aus drei Noten vereinen. (C. F. Cramer spricht in einer lobenden Besprechung von 1783 von "Schwierigkeiten und unerwarteten Fortschreitungen, die geübte und korrekte Spieler erfordern und die nicht dem Zufall überlassen werden können".) Im Stil Beethovens beginnt die Reprise nicht verhalten, sondern in einem Fortissimo-Höhepunkt.
Das Andante beruht auf Haydns eigenem Lied Gegenliebe, Hob. XXVIa: 16, das im Frühling oder Sommer 1781 komponiert, jedoch nicht vor 1784 veröffentlicht wurde. Mit Ausnahme der Bearbeitung der Klavierbegleitung für Streicher, besteht die anfängliche Vorstellung in einer wörtlichen Transkription, welche die Einschübe und das Nachspiel für Klavier allein berücksichtigt.
Das "motivisch" strukturierte Menuett gleicht dem aus dem Streichquartett, op. 33, Nr. 6, das in derselben Tonart steht. Es beruht auf einem Thema in einem 1 + 1+2 Rhythmus und besitzt ein charakteristisches auftaktiges, schrittweise steigendes Motiv in den ersten beiden Takten, das anscheinend von einem kurz—kurz—lang-Motiv in der langsamen Einleitung abgeleitet ist (!). Die Rückführung zur Reprise verlängert die Phrasierung in 5 + 5, während in der eigentlichen Reprise die chromatisch tieferen Nachbartöne in den Baß verlegt sind und eine noch deutlichere Erinnerung an die Einleitung hervorbringen. Das Trio besteht aus einem Duo für Oboe und Fagott (die Flöte tritt später hinzu); die anscheinend regelmäßigen achttaktigen Phrasen sind immer wieder auf eine unvorhersehbare Art und Weise unterteilt.
Das Finale beruht auf der Ouvertüre zu Haydns La fedeltà premiata, die im Februar 1781 uraufgeführt wurde; es war mit Trompeten und Pauken besetzt (sie fehlen in der hauptsächlichen Verbreitung der Symphonie) und besaß keine Wiederholung der Exposition, die Haydn später im Autograph hinzufügte. Eine Schlüsselrolle in der Oper ist die der Diana, der Göttin der Jagd; Haydn baute seine Ouvertüre entsprechend auf dem üblichen Jagdmotiv auf (schneller ó/8-Takt mit vorherrschenden Dreiklang-Hornmotiven, wie sie in Mozarts "Jagdquartett", KV 458 und Haydns eigenem "Jagdchor" aus den Jahreszeiten zu finden sind). Ein Thema für die Bläser (die gegen Ende der ersten Gruppe, und zwar nach einer Fermate auf der Dominante einsetzen) zitiert einen bekannten traditionellen Jagdruf, der das Jahrhundert hindurch in verschiedenen "Chasse"-Kompositionen verwendet wurde; in Handbüchern zur Jagd taucht er als "l'ancienne Vue" auf, das bedeutet das erste Sichten des Hirsches.
Im Übrigen zählt der Satz zu den erfrischendsten von Haydn: die unerbittliche Achtelbewegung und die ständig verschiedenen "Sujets" fuhren nur gelegentlich zu ruhigeren Harmonien und zu Pianostellen (immer noch mit den Achteln darunter). Am Schluß, bei der Rückkehr der "ancienne Vue" als eine Art Coda (sie wurde in der Reprise vorenthalten), erwarten wir eine grandiose Steigerung im selben Stil; es kommt jedoch zu einer Überraschung, denn die Musik wird bei der ersten folgenden Kadenz plötzlich sogar noch leiser (perdendosi) und erschöpft sich, nach einer Subdominantfärbung über einem Tonika-Orgelpunkt — wie ein Hirsch? — in Frieden.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
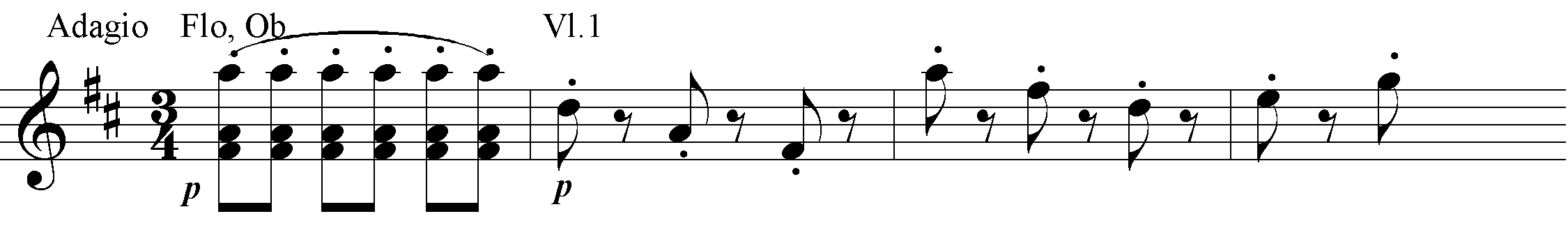
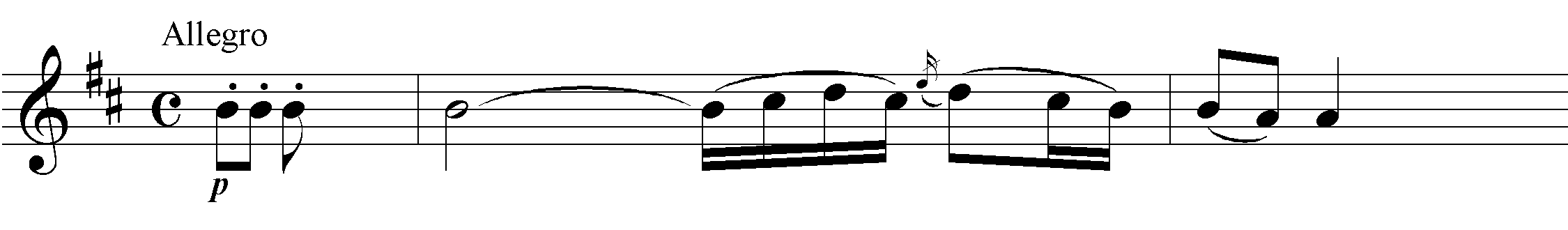
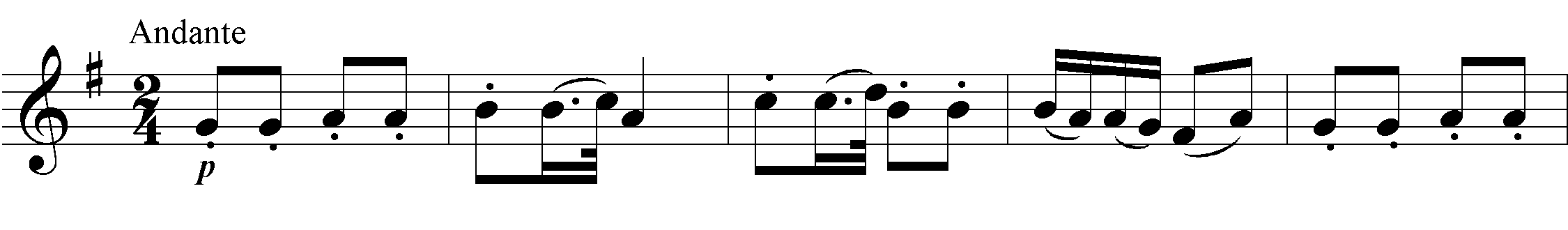
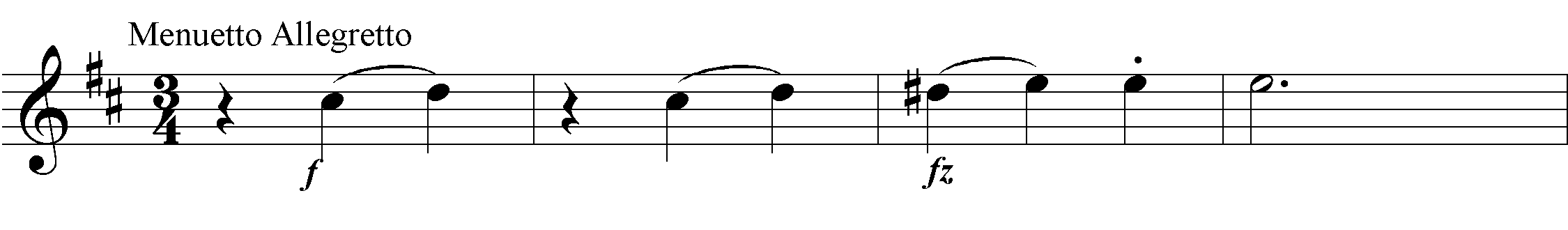
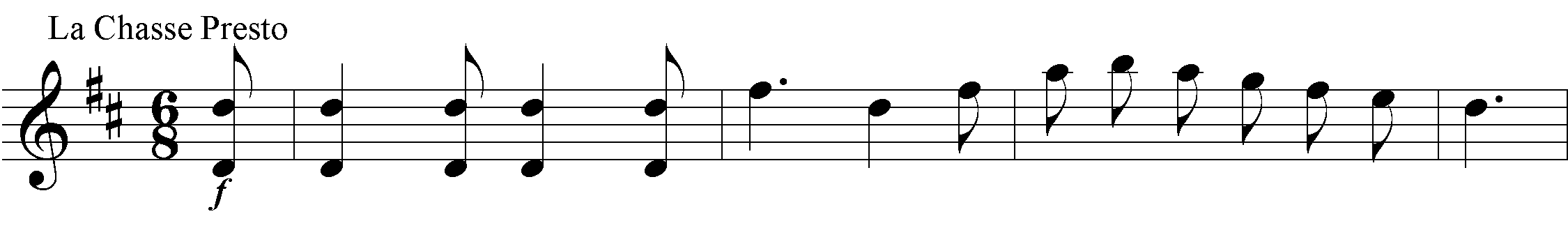
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)