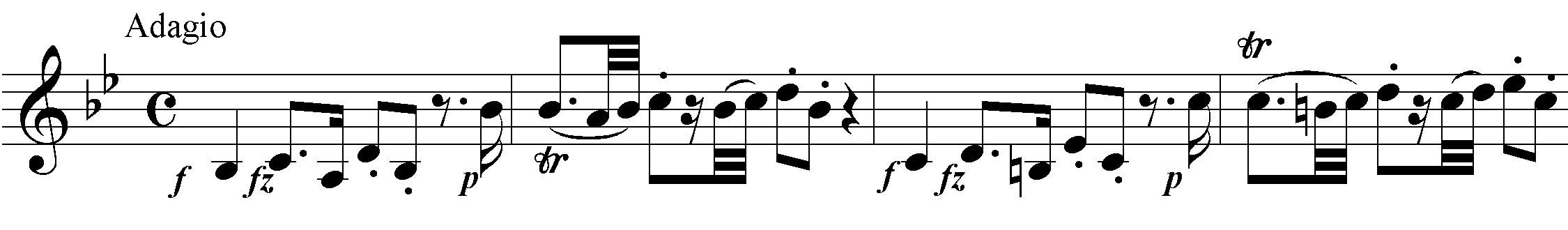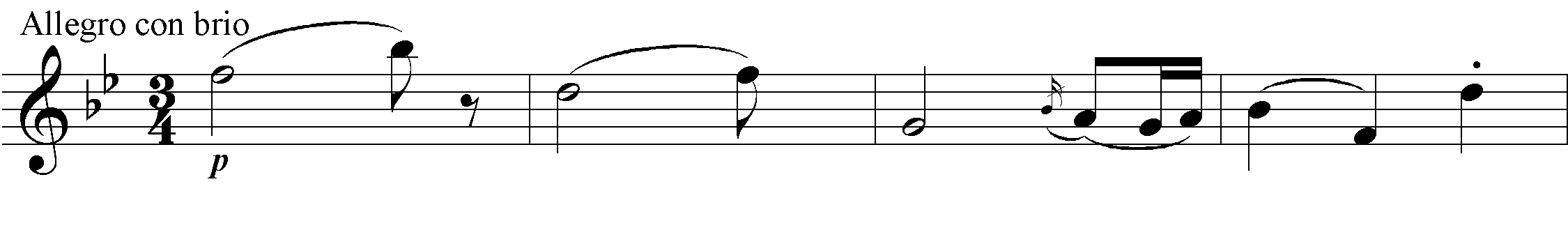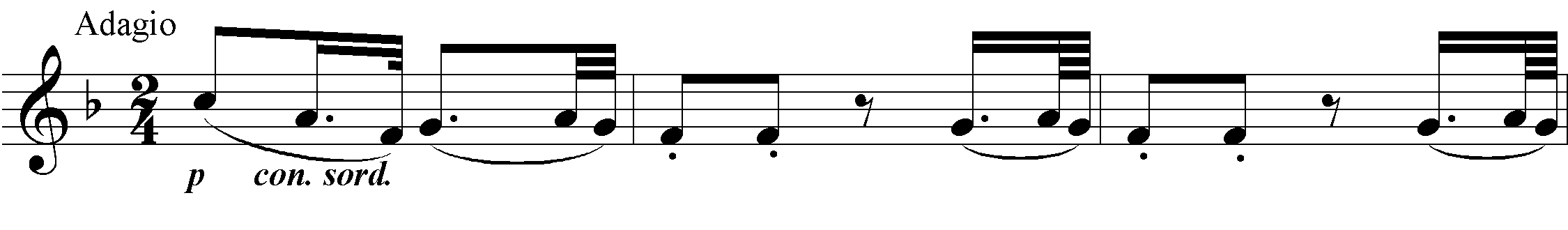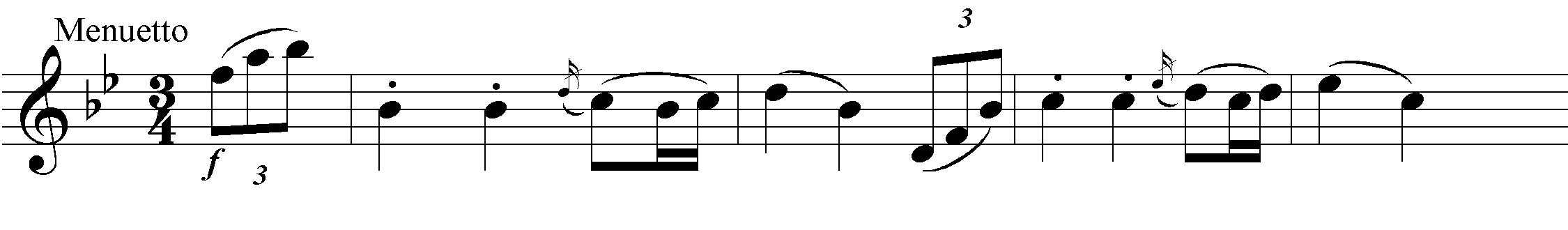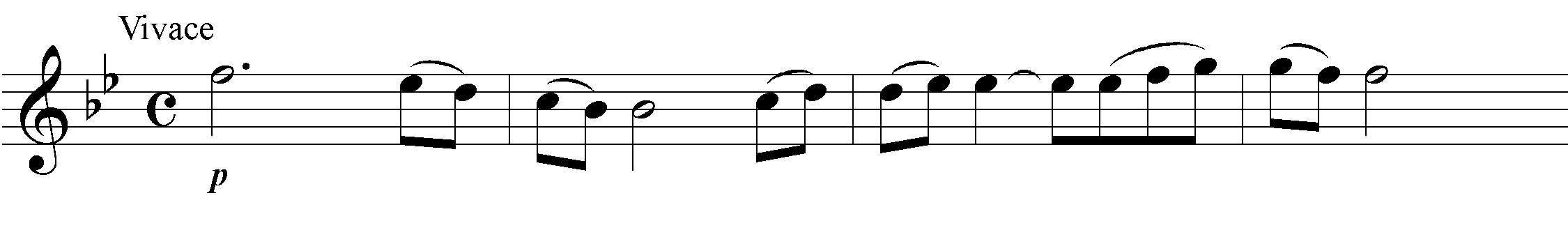71
B-Dur
Sinfonien um 1777-1779
Herausgeber: Sonja Gerlach und Stephen C. Fisher; Reihe I, Band 9; G. Henle Verlag München
Hob.I:71 Symphonie in B-Dur
Die kurze langsame Einleitung stellt meisterhaft die kontrastierenden Sujets "Majestät" (punktierte Figuren im Einklang und Forte) und "Empfindsamkeit" (getrillerte Vorhalte im Piano) nebeneinander — und zwar auf der gleichen melodischen Figur. Ihr musikalischer Gehalt wird im Verlauf des Anfangsthemas des Allegro con brio subtil wiederholt. Sobald der energische Überleitungsabschnitt die Wechseldominante erreicht, hält er plötzlich inne, und es beginnt eine grüblerische Passage, die ganz auf gleichmäßigen Vierteln aufgebaut ist, und zwar Instrument für Instrument und Takt für Takt. Dieses zögerliche Gehabe breitet sich über die eigentliche zweite Gruppe aus. Dies zeigt die für Haydn charakteristische Ausdruckskraft, die darin besteht, bis zum Eintritt des Schlussthemas nicht zurückzukehren. Die Durchführung erreicht schon bald einen Haltepunkt auf kraftvollen Oktaven (nur Oktaven) von D; nun folgt Haydns letzte ausgedehnte sinfonische "falsche Reprise" in der Tonika (spätere Beispiele stehen stets in einer anderen Tonart), die durch eine subtile Veränderung in den beiden ersten Takten verschleiert wird. Zum Ausgleich ist die "richtige" Reprise der ersten Gruppe und Überleitung stark abgekürzt.
Das Adagio ist ein Satz mit Thema und Variationen über ein kunstvolles zweiteiliges Thema, das vollständig aus komplexen fünftaktigen Phrasen (5 + 5)+(5 + 5) besteht, wobei jede Hälfte wiederholt wird; zu Beginn der vierten und letzten Phrase schaffen die Bläser mit längeren Noten und komplexeren Harmonien eine magische Wirkung. In den drei Variationen spielen abwechselnd die ersten Violinen in schnelleren Notenwerten, die Soloflöte und das Solofagott gegen eine Gegenmelodie in Zweiunddreißigsteln, und die Bässe in Triolen. Das Thema kehrt danach wörtlich zurück, wobei jedoch in der "magischen" Passage die Harmonien in einen Quartsextakkord auf der Dominante erweitert sind. Es folgt eine Fermate, die eine sehr ausgedehnte ausgeschriebene Kadenz für das volle Orchester ankündigt, wonach der Satz mit einer sehr kurzen Coda endet.
In dem Menuett kontrastiert ein schreitendes Forte-Thema mit einer Piano-Antwort, die chromatische Nachbartöne in parallelen Dezimen bringt, die sich in dem ausgedehnten zweiten Teil "breitmachen"; im Trio wird die ungewöhnlich phrasierte siebentaktige Melodie von zwei Soloviolinen in Oktaven gespielt, in der eine hervorspringende Drehfigur erscheint (die im zweiten Teil beinahe zu hervorstechend erscheint). Das mit Vivace bezeichnete Finale in der Sonatenhauptsatzform bringt ein sich unregelmäßig entwickelndes Thema über einem Bass in gleich bleibenden Achteln, der sich jedoch harmonisch langsam bewegt; es kehrt (in einer Variante) in der zweiten Gruppe zurück, die mit einem fanfarenartigen Thema in den Bläsern und einem witzigen Decrescendo schließt. Die Durchführung beginnt unvermittelt in der entfernten Tonart Des-Dur, wobei die beiden Violinstimmen im Einklang geführt sind (beide sind in einer frühen Quelle mit "per licentiam" bezeichnet, eine Art von Anmerkung, die gelegentlich in Haydns Autographen zu finden ist); nach einigen "rätselhaften" Modulationen verwandelt sich Des in Cis; d. h. die Wechseldominante in g-Moll, das die parallele Molltonart ist. Die Reprise wird durch einen von Haydns weniger subtilen Scherzen vorbereitet.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
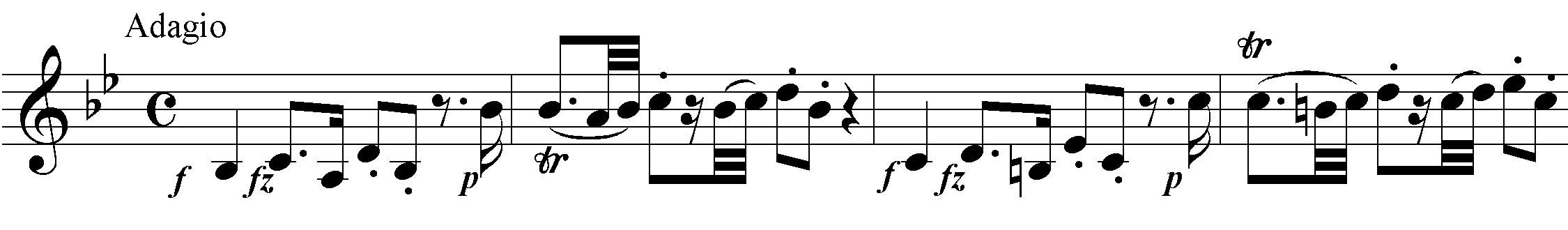
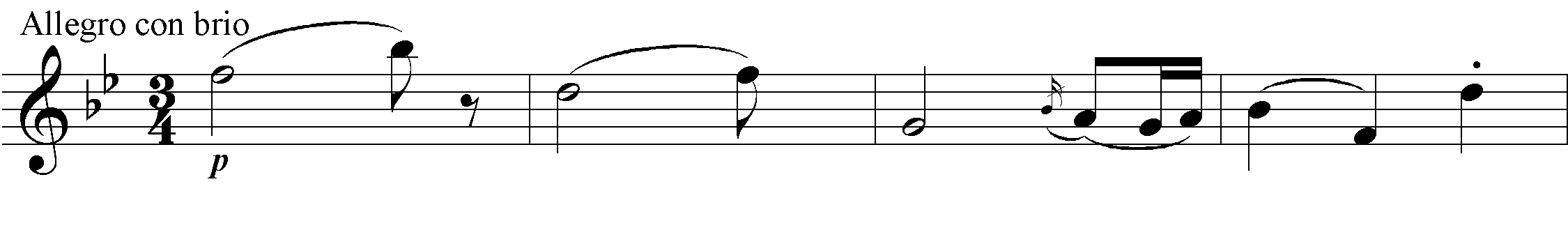
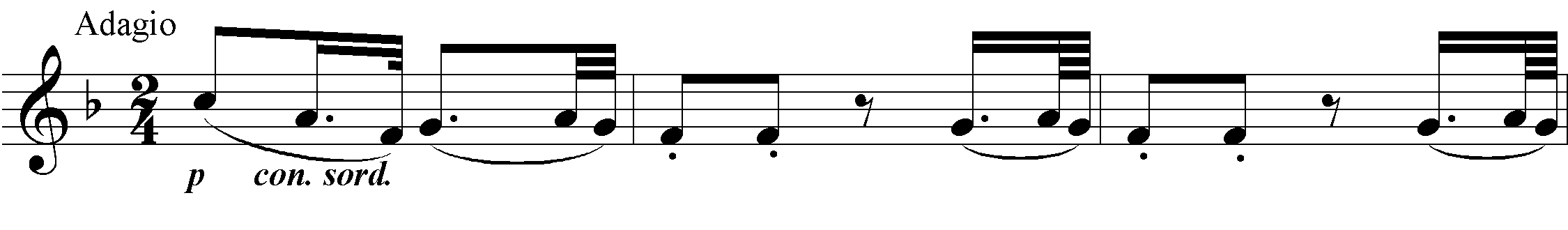
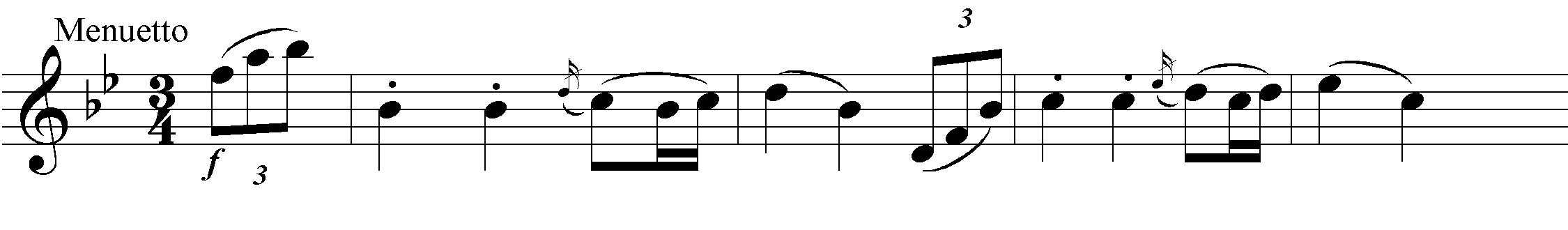
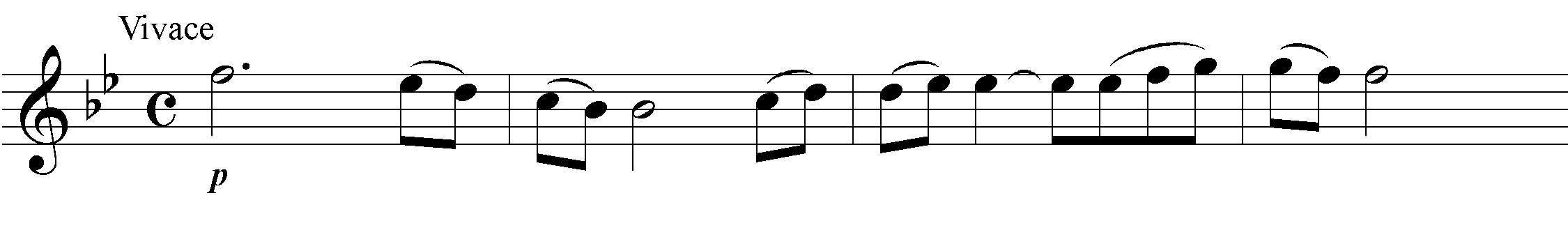
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)