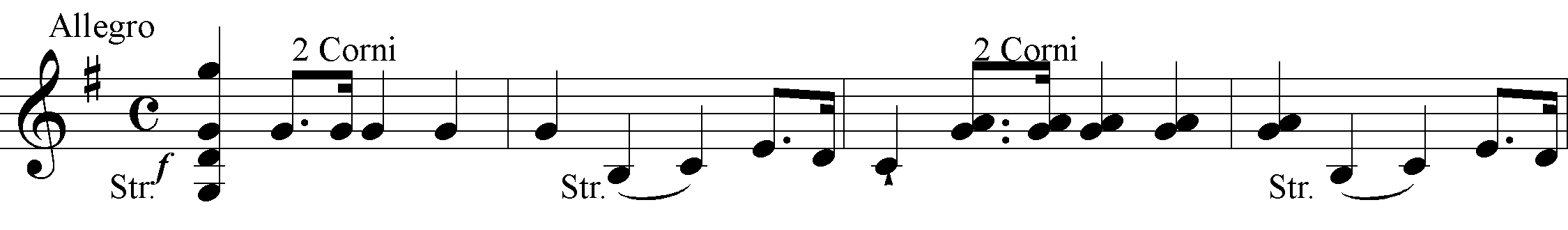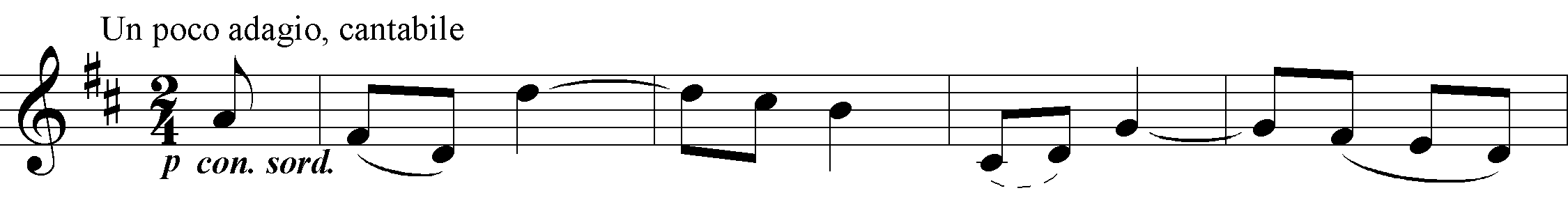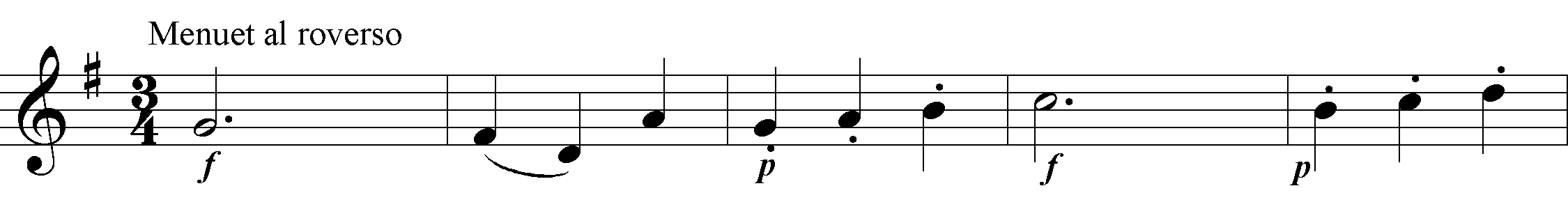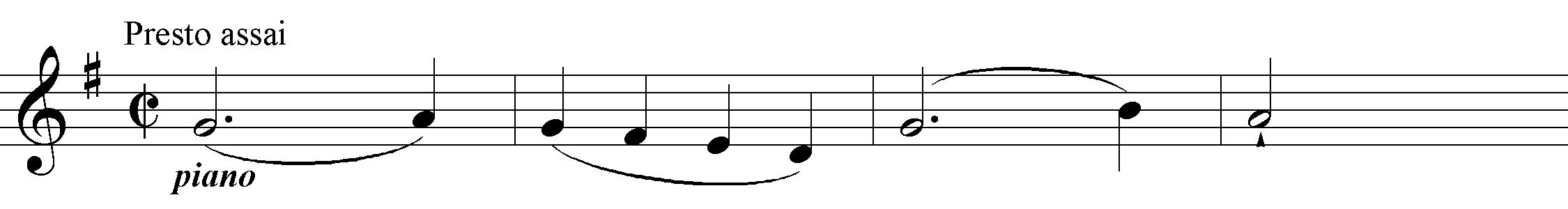47
G-Dur
Sinfonien 1767-1772
Herausgeber: Carl-Gabriel Stellan Mörner; Reihe I, Band 6; G. Henle Verlag München
Hob.I:47 Symphonie G-Dur
Im Gegensatz zu den Nr. 45 und 46 ist diese Symphonie in einer ganz "normalen" Tonart gesetzt und weist die übliche Reihenfolge von vier Sätzen auf, ohne dass damit offenbar Assoziationen außerhalb der Musik verbunden wären. Wenn man daraus jedoch den Schluss zieht, dass sie nicht auf der gleichen hohen Ebene angesiedelt ist, wird man Haydns Kunst nie verstehen können.
Das Anfangsallegro beginnt mit einem bemerkenswerten, martialischen Thema (punktierte Motive), in dem sich dissonante Hornfanfaren, zu denen sich später die Oboen gesellen, mit Streichermotiven abwechseln. Das ganze steigert sich zu einem ersten Höhepunkt. Der martialische Topos setzt sich durch das Gegenthema und die Überleitung fort, bis es sich in der Dominante in ein ruhiges Triolenthema fügt. Dies führt direkt zu einer kurzen Schlussgruppe. Die Durchführung beginnt mit einer modulierenden Pianopassage, die auf dem martialischen Thema basiert, das schließlich in Kombination mit den Triolen im Forte ausbricht. Ein langer, dissonanter Orgelpunkt auf dem martialischen Motiv führt zu einer Wiederholung des gesamten zweiten Themas, bei dessen Kadenz die Triolen im Forte erklingen und zur Reprise führen. Hier sieht Haydn etwas außerordentlich Überraschendes vor, das man erst bei Schubert wieder hören sollte: das Anfangsthema erscheint neu in der Molltonika, und die Anlage ist entsprechend dissonanter. Schließlich fuhrt es, als ob nichts Ungewöhnliches passiert wäre, direkt zu dem Triolenthema. Obwohl der restliche Teil alles kurz wiederholt, erscheinen die verschiedenen Themen in einer völlig unterschiedlichen Reihenfolge.
Der langsame Satz ist eine beeindruckende Kombination von Kontrapunkt und Variationsform. Das Thema ist in A B A'-Form. Der A-Teil besteht aus fünftaktigen Phrasen.
Er ist nur für Streicher, in zweistimmigem doppeltem Kontrapunkt. Der B-Teil mit einer dichteren Satzstruktur umfasst eine viertaktige Phrase plus eine sechstaktige Erweiterung. Die Bläser setzen mit wunderbaren Klangfarben ein. Der Abschnitt A', ebenfalls nur für Streicher, wiederholt A, wobei die zwei Stimmen umgekehrt werden. Danach folgen drei vollständige Variationen nach dem Prinzip der "Verdoppelung", d.h. schnellere Notenwerte in jeder folgenden Variation. Haydn gibt diese Vorgehensweise schließlich zugunsten einer endgültigen Variation auf, an der die Bläser von Anfang an schöner als je zuvor beteiligt sind. Diese Variation endet jedoch in einem Trugschluss, der zu einer ausgedehnten Coda und einem Pianissimo-Schluss führt.
Das Menuett "al roverso" übertrifft all dies mit Leichtigkeit. Jeder Satzabschnitt, Menuett und Trio, umfasst lediglich eine einzige Periode ausgeschriebener Musik. In beiden Fällen entwickelt sich der zweite Abschnitt, indem der erste Teil rückwärts gespielt wird. Im Gegensatz zu einem "Krebskanon", in dem kontrapunktische Einfalle oder strukturelle Komplexität reichlich vorhanden sind, ist diese Musik gänzlich homophon. Von Haydns Glanzleistung bei der Komposition von Harmonien und Rhythmen, die in beiden Richtungen sinnvoll sind, kann uns nichts ablenken.
Das Finale ist mit "Presto assai" bezeichnet. Es beginnt atemlos, piano und nicht in der Tonika. Kein kontrastierendes Forte von Bedeutung ist hörbar, bis es zu einer gewaltigen Explosion in der Dominante kommt, die sich bald nach Moll wendet. Die eigentliche zweite Gruppe wiederholt das Hauptthema und führt schließlich zu einer kurzen Schlussgruppe. Am Anfang der Durchführung beweist Haydn erneut, dass er jegliche Erwartungen zunichte machen kann. Das Hauptthema erscheint in der Subdominante und führt mit einer forte/piano-Sequenz zu der "explosionsartigen" Passage in e-Moll, einschließlich einiger haarsträubender Horndissonanzen. Die Reprise ist mehr oder weniger regelmäßig, bis die Schlussgruppe zum endgültigen Höhepunkt führt.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
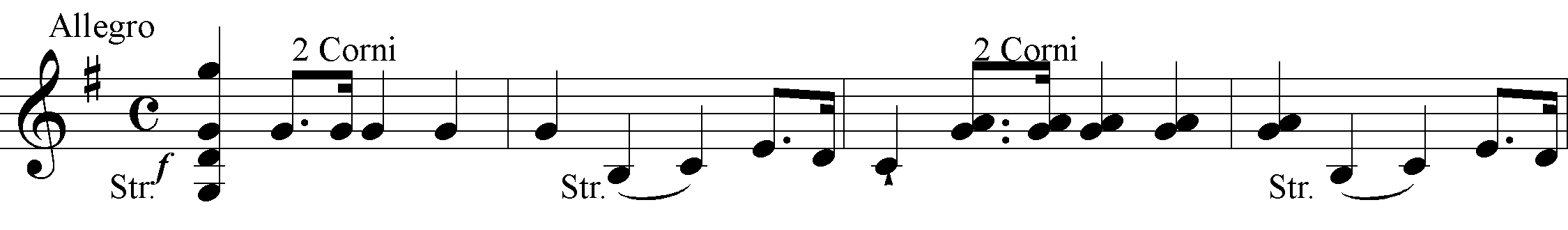
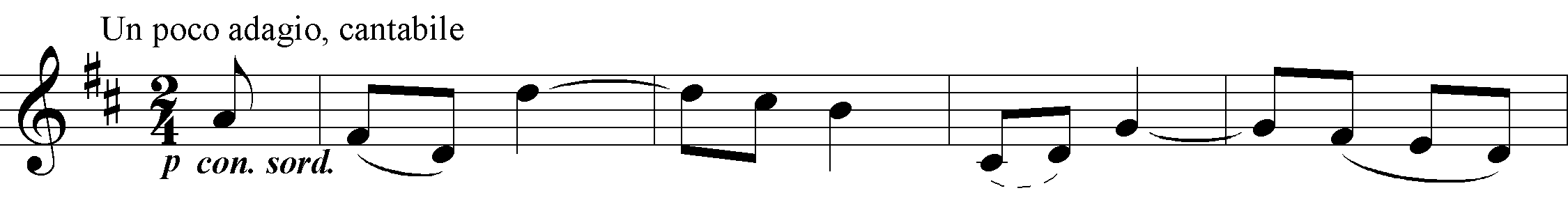
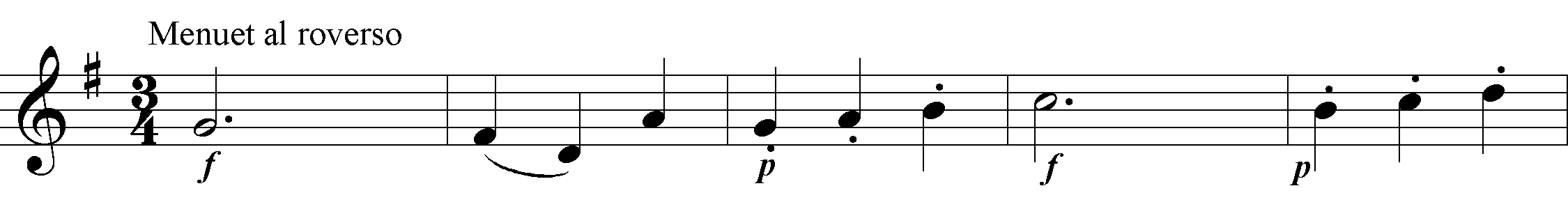
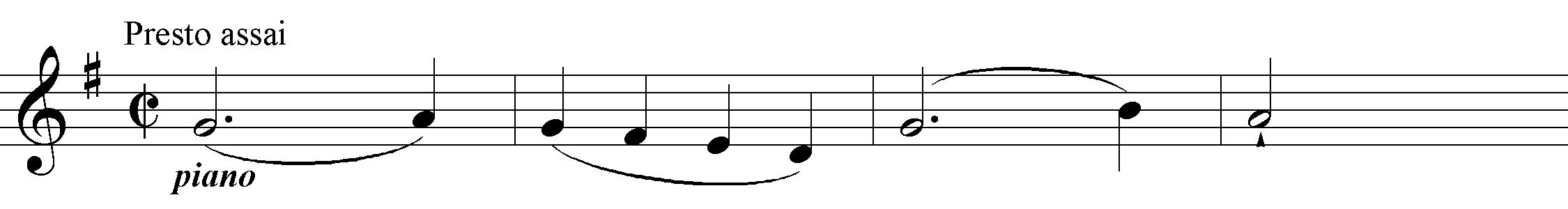
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)