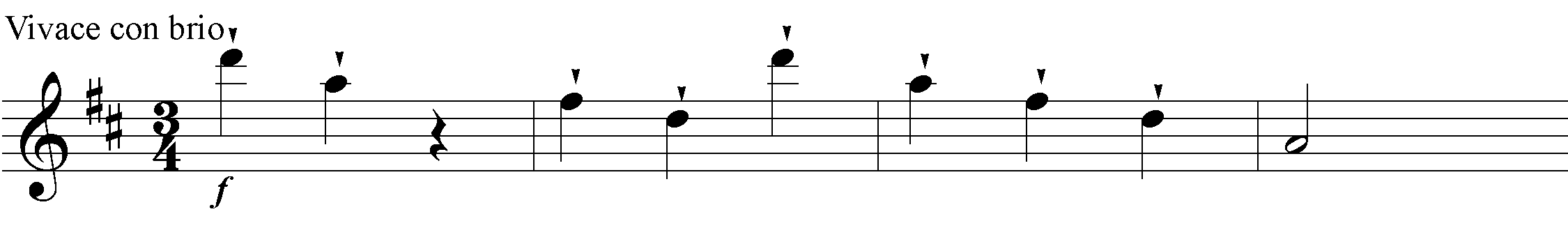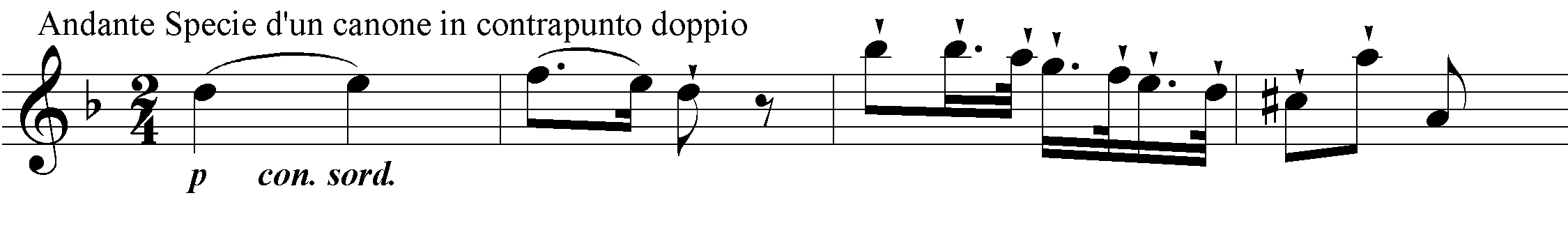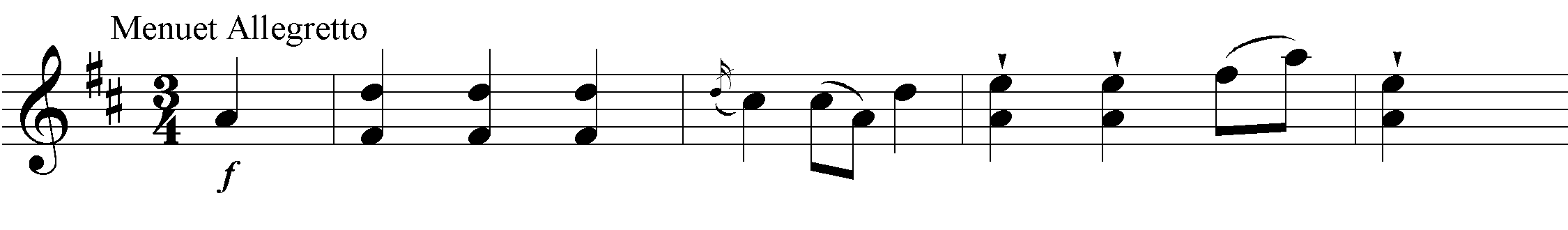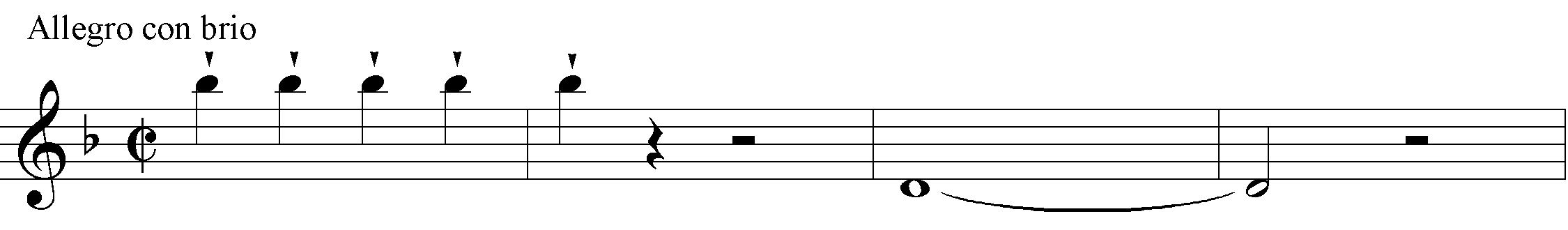70
D-Dur
Sinfonien um 1777-1779
Herausgeber: Sonja Gerlach und Stephen C. Fisher; Reihe I, Band 9; G. Henle Verlag München
Hob.I:70 Symphonie in D-Dur
Diese ungewöhnliche Symphonie hat sich seit der anerkennenden Besprechung durch H. C. Robbins Landon aus dem Jahre 1955 unter den Haydnliebhabern eines großen Ansehens erfreut. Sie steht in D-Dur/Moll; das komplexe Dur-Moll-Geschehen steht in Beziehung zu dem für die Musik des 18. Jahrhunderts so wichtigen Kontrast zwischen dem ernsten bzw. "gelehrten" und dem leichten bzw. "galanten" Stil: Der erste Satz und das Menuett sind brillante, vorwärts treibende Sätze in D-Dur und im 3/4-Takt, während der langsame Satz und (zum größten Teil) das Finale in d-Moll und im geraden Takt stehen sowie "demonstrativ" kontrapunktisch angelegt sind. Haydn handhabt jedoch, wie im analogen Fall des Streichquartetts, op. 20, Nr. 2 (1772), diese Beziehung auf unerwartete und tiefgründige Weise.
So beginnt der erste Satz, Vivace con brio, der so schnell ist wie praktisch ein auf einem einzigen Schlag gezählter Takt, mit einem bemerkenswerten fallenden Motiv aus zwei Noten, das sich unmittelbar zu absteigenden Arpeggierungen des Dreiklangs entwickelt. Noch in der Grundtonart bringt eine im Piano stehende Beantwortung desselben Motivs im Abstand von zwei Takten eine Imitation mit dem Bass. Das Motiv kehrt danach als die hauptsächliche Idee der zweiten dominantischen Gruppe zurück; es wird wiederum vom Baß imitiert, hier jedoch im Abstand von nur einem Schlag, was eine quasi-kanonische Struktur ergibt; es wird in der Durchführung einer weiteren kontrapunktischen Behandlung unterzogen. In der Reprise wird erstaunlicherweise ein bisher unauffälliges, schrittweise steigendes Motiv einer derartigen komplexen Behandlung unterworfen. All dies ist jedoch verschmolzen mit unkomplizierten, schwungvollen homophonen Passagen: Der Kontrapunkt erhält, gleichwohl er verwendet wird, keine beherrschende ästhetische Bedeutung.
Das Andante in d-Moll, ein doppelter Variationssatz mit alternierenden Moll- und Durabschnitten (A-B—A1—B2-A2), ist völlig gegenteilig angelegt. Haydn bezeichnet das Hauptthema ein wenig ostentativ als "Specie d'un canone in contrapunto doppio"; der erste Abschnitt mit seiner a1a2ba3-Form besteht aus nur zwei Stimmen, die, zusammen mit den punktierten Rhythmen, eine ausgesprochen unheimliche Atmosphäre schaffen. Und tatsächlich findet im a2-Abschnitt eine Umkehrung der Stimmen statt; das Thema, nun im Bass, wird als "canto fermo" bezeichnet und von einer neuen Mittelstimme in Dezimen begleitet. Nach dem sehr kurzen b-Abschnitt verlegt a3 den ursprünglichen Bass, der als "contrapunto" bezeichnet ist, in die Mittelstimme, während ein neuer Bass zum Schluss für die erforderliche harmonische Stabilität sorgt. Die B-Abschnitte stehen im heitersten D-Dur und enthalten eine reizenden Melodie, die "Dreh-Motive" in schnellen Noten und beinahe ständig Zweiunddreißigstelnoten in B1 bringt; die Zweiunddreißigstel sind jedoch auch überall in A1 präsent. Dieser Satz bringt so sehr Moll-Dur-Kontraste zur Geltung — das Ziel der Symphonie aufs Ganze gesehen —, dass Haydn es sich leisten kann, mit einer einfachen Reprise von A zu schließen, die nur mit Hilfe von gelegentlichen chromatischen Durchgangsnoten und zwei kadenzierenden Schlusstakten ausgearbeitet ist.
Das ausgelassene Menuett ist homophon und rhythmisch durch regelmäßige Zweier und Vierereinheiten ausgestaltet; dies wird durch ständig variierte Harmonisierungen des ersten Takts der viertaktigen Hauptidee ausgeglichen. Das kurze Trio steht dazu in völligem Kontrast: piano, legato und (wie das Thema des langsamen Satzes) nur zwei Stimmen, die jedoch (anders wie das Thema des langsamen Satzes) homophon gestaltet sind und sich bei jeder Kadenz in bloßen Oktaven vereinigen. Haydn schreibt zum ersten Mal in einer Symphonie für das wiederholte eigentliche Menuett eine separate Coda, in der das Äquivalent für den siebten Takt schließlich eine entsprechende ausgeprägte kadenzierende Harmonisierung erhält.
Das Finale ist der Schlussstein dieser bemerkenswerten Symphonie. Es beginnt homophon und im Pianissimo, mit einem nackten, hohen Motiv aus Tonwiederholungen in Vierteln in den ersten Violinen, die mit dem Legato der tieferen Streicher alternieren; dies ist eine Kombination, die manche als Anspielung auf die Buffa-Oper gehört haben. Plötzlich donnern die Tonwiederholungen im Forte los, und wir bewegen uns zur Dominante, um dort zu verweilen. Nun beginnt eine strenge Fuge "a 3 soggetti in contrapunto doppio"; das höchst markante Fugenthema weist dieselben Tonwiederholungen in Vierteln auf, doch wieder vereinigen sich das "Galante" und Gelehrte. Die Fuge führt, wie immer bei Haydn, in ihrem Verlauf zu neuen kontrapunktischen und rhetorischen Kombinationen; eine der bemerkenswertesten besteht in einer kanonisch geführten Passage, die nur aus dem Motiv mit den Tonwiederholungen in Vierteln besteht, während die beiden übrigen Themen wegfallen. Wie immer setzt sich der Sonatenstil schließlich wieder durch: Ein langer dominantischer Orgelpunkt fuhrt schließlich zu einer perfekten authentischen Kadenz mit Schlusswirkung. Wir sind jedoch noch nicht am Schluss angelangt: Die homophone "opernmäßige" Musik kehrt zurück und führt über ein überraschendes Wiederaufgreifen des Forteausbruchs zu einem weiteren dominantischen Orgelpunkt. Nun beginnt erneut die Fuge, und zwar erstaunlicherweise in D-Dur (die Tonart des "Galante"); das Thema mit den Vierteln funkelt triumphierend in den Hörnern und Trompeten (die wegen des Fehlens der erniedrigten Terz ihrer Naturskala in der Molltonart nicht spielen konnten). Doch auch hier kommt die Symphonie nicht zu ihrem Schluss: Die Fuge bricht beinahe sofort ab, und die "opernmäßige" Musik kehrt zum letzten Mal zurück und führt zu einem scherzhaften und doch gehaltvollen Schluss, den zu beschreiben geistlos wäre. Im ganzen Verlauf der Symphonie verwandeln sich zwei Welten — Dur und Moll, "galant" und gelehrt — in eine einzige.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
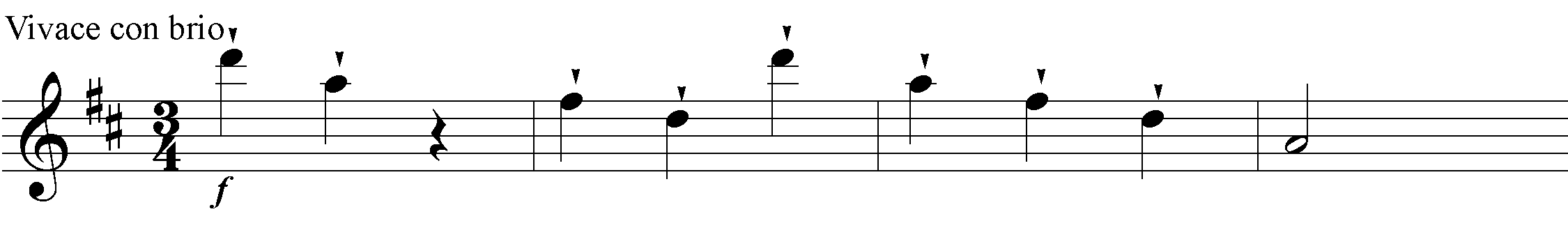
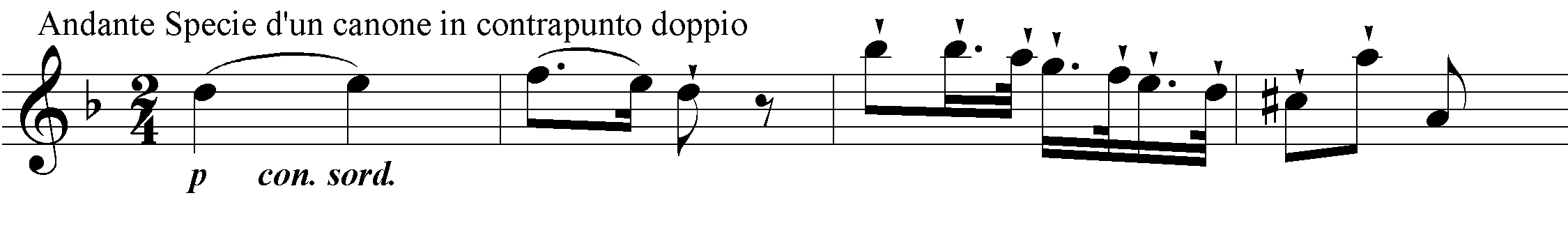
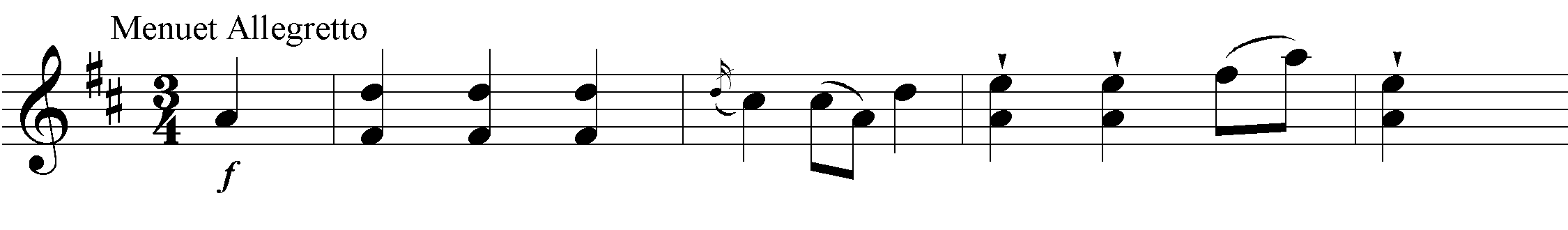
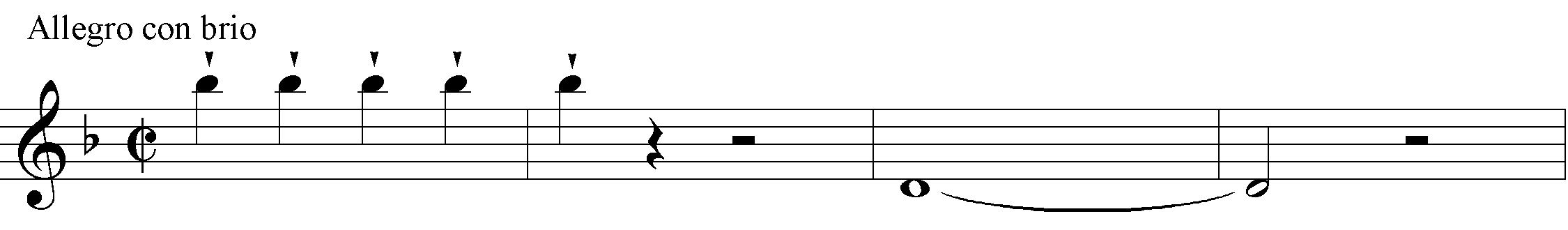
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)