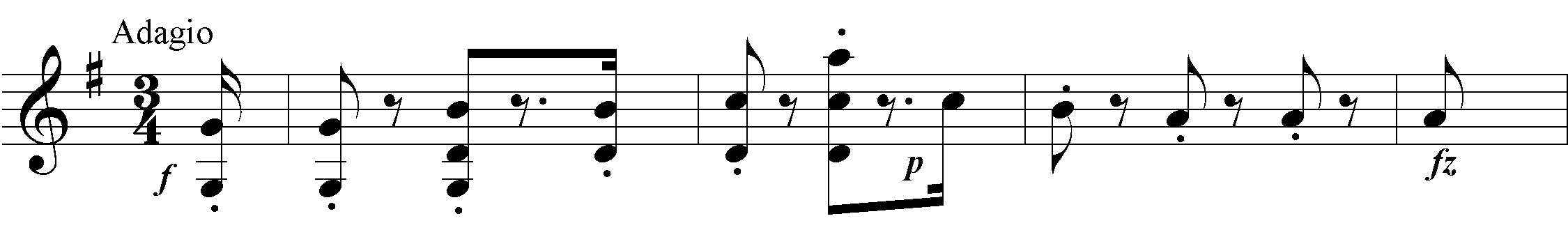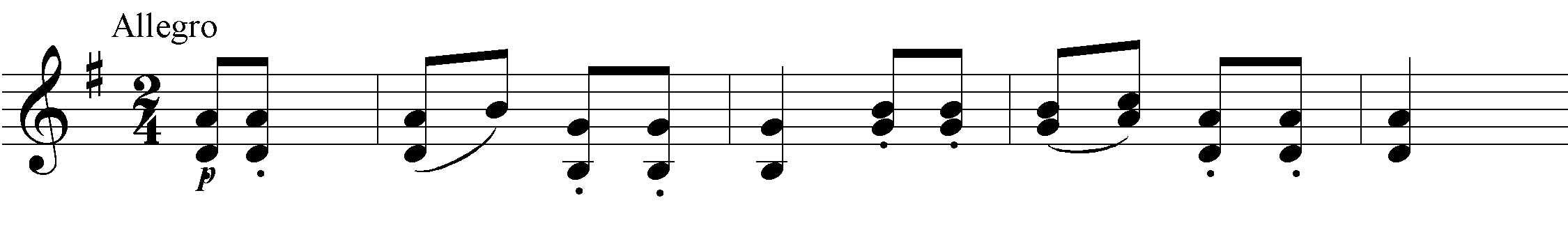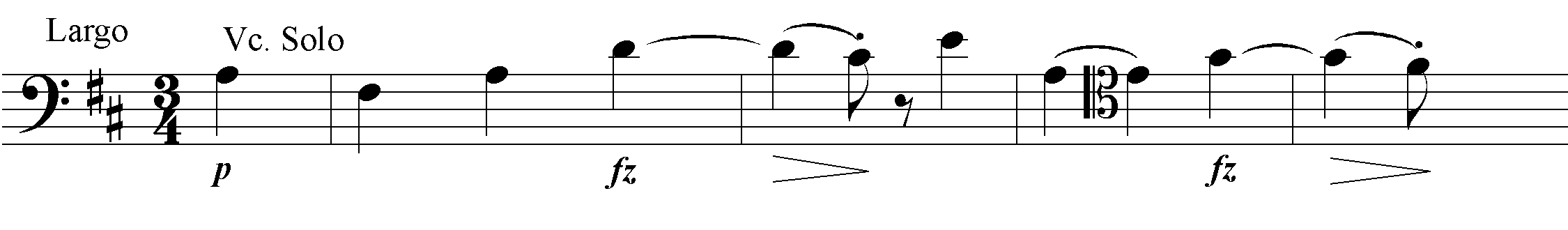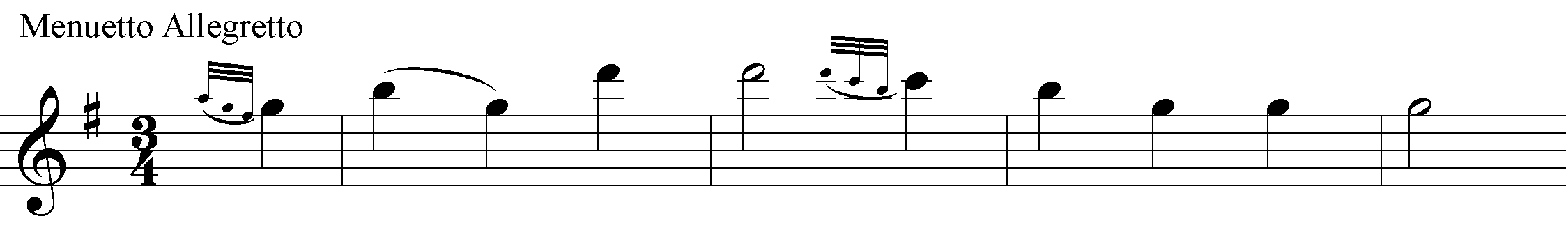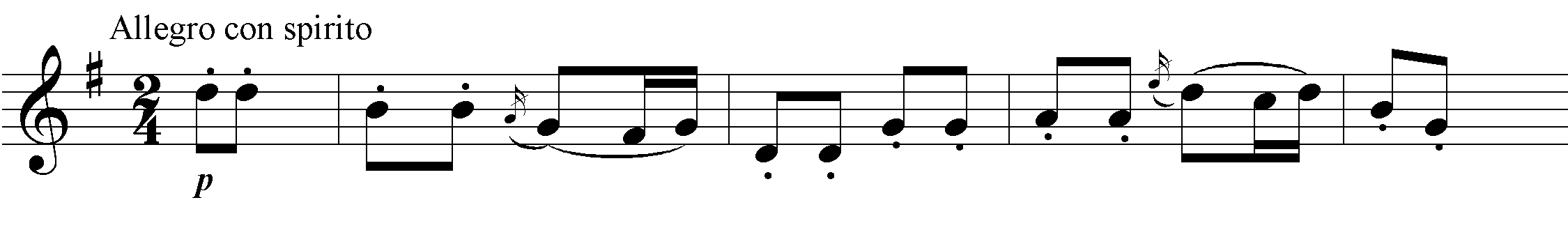88
G-Dur
Sinfonien 1787-1789
Herausgeber: Andreas Friesenhagen; Reihe I, Band 14; 2010, G. Henle Verlag München
Hob.I:88 Symphonie in G-Dur
Die 1787 komponierte Symphonie Nr. 88, ist die erste jenes Symphonienpaars, das Joseph Haydn dem Esterházyschen Geiger Johann Tost auf dessen Reise nach Paris mitgab, um damit das Interesse der Pariser für Haydns Kompositionen warm zu halten. Ungewöhnlich an dieser G-Dur-Symphonie ist, dass Haydn die Trompeten und Pauken den ganzen ersten Satz pausieren lässt. Man hat das der Tatsache zugeschrieben, dass Haydn lange und mit Unterbrechungen an dieser Symphonie gearbeitet haben muss, sodass er die Besetzung des ersten Satzes „vergaß”. Viel eher dürfte aber doch wohl kalkulierte kompositorische Ökonomie dafür verantwortlich sein, dass diese Instrumente für den Überraschungseffekt im zweiten Satz aufgespart werden, denn dass Haydn als „professioneller Komponist“ einfach darauf vergisst, ist zu absurd. Und hört man das Werk im Zusammenhang muss man wieder einmal erkennen, wie einfach es für Haydn ist, ohne besonderen Aufwand große Wirkung zu erzielen. Man mache sich nur bewusst, dass nicht irgendwelche Instrumente aufgespart werden, sondern eben Pauken und Trompeten - um dann eingesetzt zu werden, wenn man eher eine „Beruhigung“ erwartet - nämlich im zweiten Satz. Doch zurück zum Beginn der Symphonie. Der erste Satz bedarf der langsamen Einleitung, denn sein erstes Thema ist äußerst knapp, eigentlich nur eine rhythmisch akzentuierte Drehfigur von geringer melodischer Individualität. Die Einleitung verführt den Zuhörer in die Erwartung, dass nun „Gewichtiges“ folgen wird. Doch ist es ein fast schon spartanisches Thema das präsentiert wird, Haydn jedoch gleichzeitig Gelegenheit zur Entfaltung besonderer kompositorischer Virtuosität und orchestraler Brillanz gibt. Zudem tendiert der Satz zur Monothematik mit äußerst beiläufigem Seitenthema. Wie man überhaupt versucht ist zu meinen, Haydn hätte sich die „Denksportaufgabe“ gestellt, mit „wenig Thema“ einen packenden Satz (und zwar nach allen „Regeln“ der Kunst) zu erschaffen.
Berühmtheit hat vor allem der zweite Satz errungen, wohl wegen seiner melodischen und klanglichen Vollkommenheit, verbunden mit der kompositorischen Fertigkeit Haydns, ein Grundmaterial sieben Mal zu variieren, ohne die melodische Substanz wesentlich zu verändern und doch jedes Mal ein “Neues” hinzustellen. Das Finale ist ein Perpetuum-mobile-”Kehraus”, wo wie im ersten Satz aus einem unscheinbaren Motivkern eine Fülle von Variations- und Kombinationsmöglichkeiten entfaltet werden. Es ist einer jener Sätze, die dem Zuhörer als „Ohrwurm“ noch Stunden nach dem Ende in den Ohren klingen. Gewagt ausgedrückt jedoch ein „Schlager“.
Analyse

Analyse der Sätze
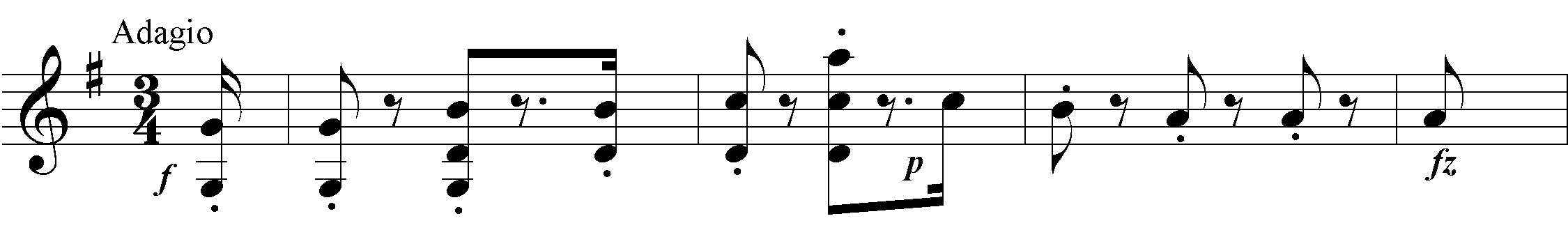
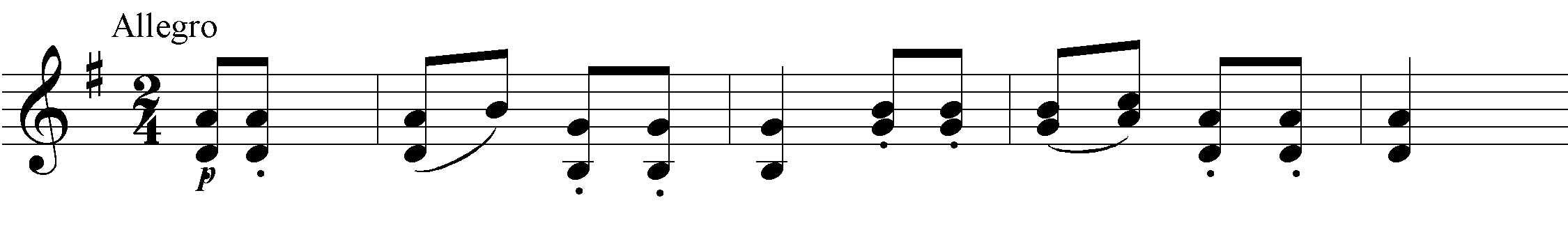
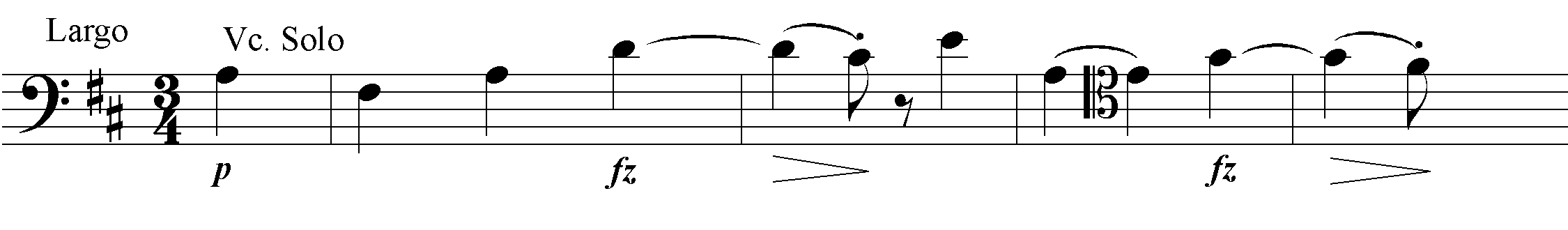
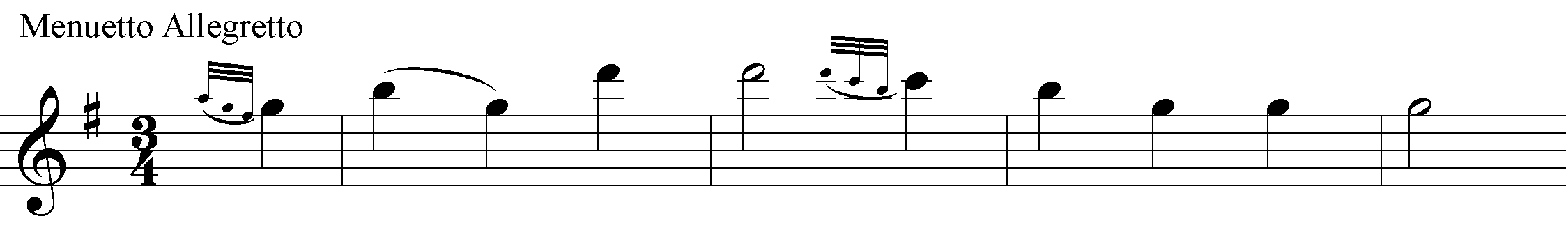
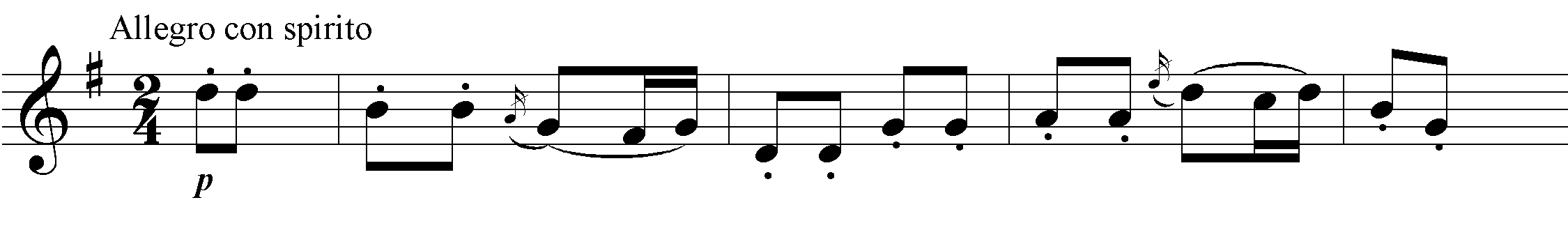
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)