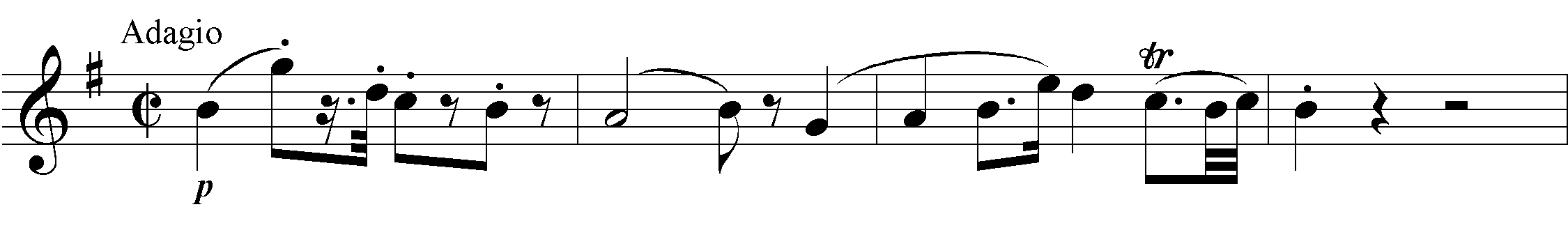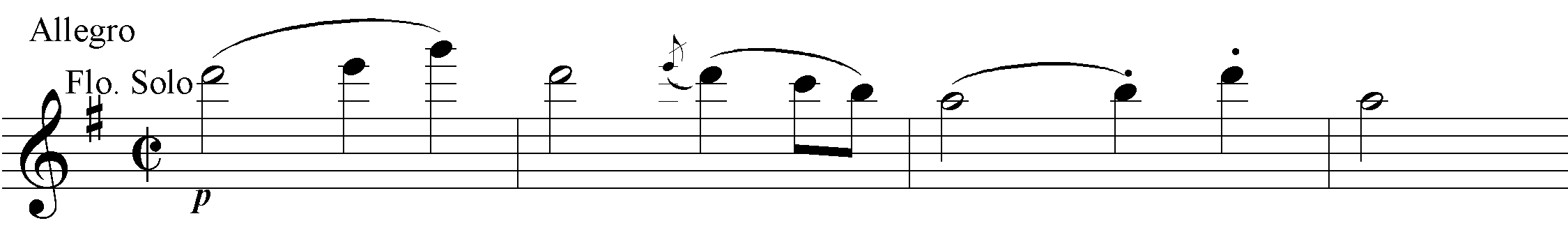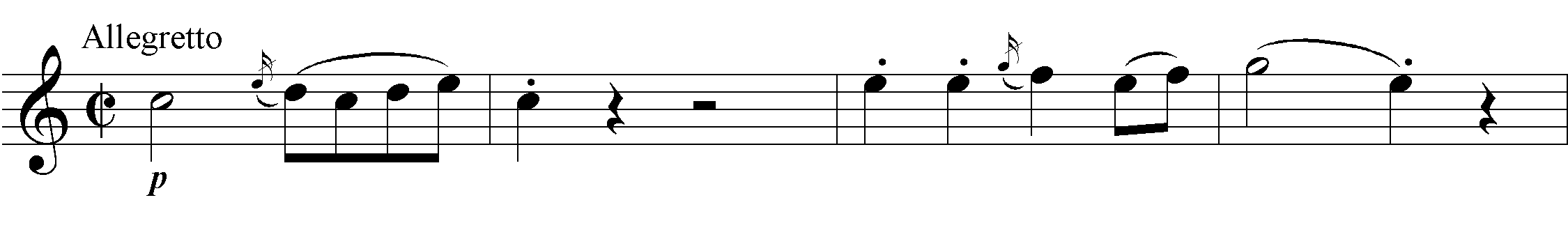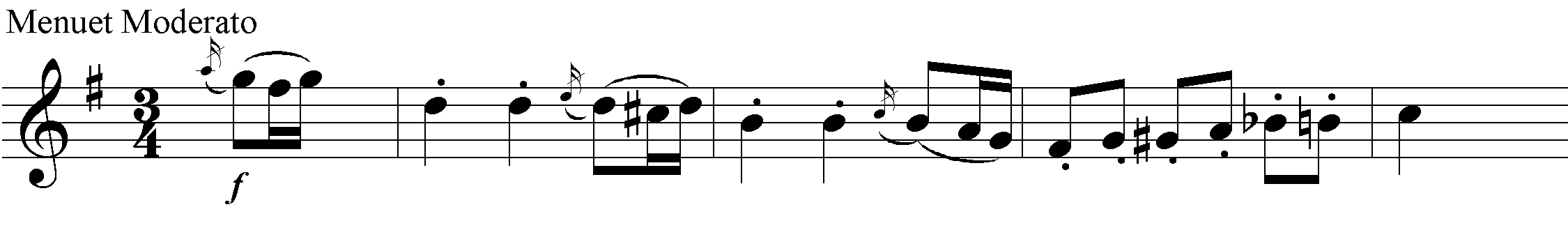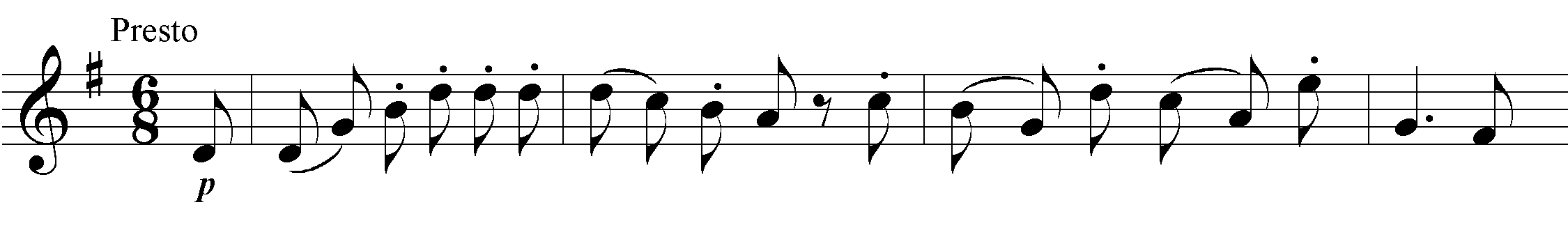100
"Militärsinfonie"
G-Dur
Londoner Sinfonien, 3. Folge
Herausgeber: Horst Walter; Reihe I, Band 17; G. Henle Verlag München
Hob.I:100 Symphonie in G-Dur „Militärsymphonie“
Die „Militär-Symphonie“, geschrieben 1794 während des zweiten Londoner Aufenthalts (1794/95), gehörte von allem Anfang an zu den größten Londoner Erfolgen, wenn nicht gar zu den beliebtesten Kompositionen Joseph Haydns überhaupt. Sie hat ihren Namen vom Instrumentarium (Große Trommel, Becken, Triangel), das Haydn im zweiten und vierten Satz vorsieht, und repräsentiert eines der prominentesten künstlerischen Dokumente für die Tatsache, dass die europäische Kunstmusik ihre Schlagzeug-Besetzung, die auf die Musik der Janitscharen (der türkischen Elitesoldaten) zurückgeht, eigentlich mehr oder minder den Türkenkriegen verdankt.
Die Popularität, die die „Militär-Symphonie“ stets genoss, ist zweischneidig, denn der Effekt, auf dem sie beruht, ist eigentlich ein komponiertes Schockerlebnis. Die ganze Symphonie wurde von Haydn gleichsam um den bereits vorher in anderer Form existierenden zweiten Satz „herum“ geschrieben: Dieser stammt nämlich aus dem dritten der fünf Konzerte für zwei Radleiern (Hob. VIIh:1–5), die Haydn 1786 im Auftrag des Königs Ferdinand IV. von Neapel komponiert hatte, und ist dort mit „Romance“ überschrieben. (Die Rad- oder Drehleier, italienisch: „Lyra organizzata“, ist ein ungewöhnliches, noch aus dem Mittelalter herstammendes Instrument, bei dem die Saiten durch ein Kurbelrad gestrichen werden.) Haydn hat jedoch am Schluss dieses Satzes etwas völlig Überraschendes angefügt: Es ertönt ein Militärsignal in der Trompete, der von einem vollen Einsatz von „Militärmusik“ im Fortissimo gefolgt wird. Haydn – ein Schostakowitsch des 18. Jahrhunderts: Mit einer Drastik, die in der Musik der Wiener Klassik ohne Beispiel ist, ist hier im musikalischen Medium nachvollzogen, wie die Gewalt des Krieges über eine friedliche Idylle hereinbricht. Dabei hat Haydn dem Zuhörer keinerlei Vorwarnung gegeben: Der erste Satz ist heiter und leicht, ja beinahe fröhlich. (Vom Seitenthema des ersten Satzes hat man oft behauptet, es nehme den „Radetzkymarsch“ voraus.) Auch mit den übrigen Sätzen dürfte Haydn eine populäre Tonlage gefunden haben, die den Nerv ihrer Zeit traf: Mit dem Sechsachteltakt-Hauptthema des Schlusssatzes hat man den interessanten Fall vor sich, dass ein Haydnsches Symphoniethema zur englischen Volksmelodie geworden ist, wie Sammlungen von Country-Dances aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts beweisen. Wenn im vierten Satz die Militärmusik mit allem Lärm wiederkehrt, dann hat sie allerdings ihr Bedrohungsbild verloren und verstärkt die Wirkung des Finalschlusses.
Haydn und der Krieg: Haydn verwendet zwar das türkische Janitscharenmusik-Instrumentarium, aber es ist nicht mehr das osmanische Bedrohungsbild vom Anfang des 18. Jahrhunderts, sondern ein neuer Aggressor, auf den man – zeithistorisch – Haydns Militärmusik-Kunstgriff beziehen muss: Dass Haydn für den zweiten Satz ausgerechnet ein Lirenkonzert für den Neapolitanischen König verwendet, wächst sich geradezu zu einem zeithistorischen Symbol aus: Ferdinand IV. von Neapel ist ein Bruder Ludwigs XVI. von Frankreich; seine Frau Caroline ist Tochter Maria Theresias und Schwester Marie Antoinettes, die wie ihr Gatte ihr Leben unter dem Schafott der Französischen Revolution beenden musste: Im Kontrast zwischen der idyllischen „Romance“ und der Militärmusik im zweiten Satz der „Militär-Symphonie“ hat Haydn also nichts Geringeres musikalisch eingefangen als den zentralen europäischen Umbruch am Ende des 18. Jahrhunderts: das Ende des Ancien Régime.
Analyse

Analyse der Sätze
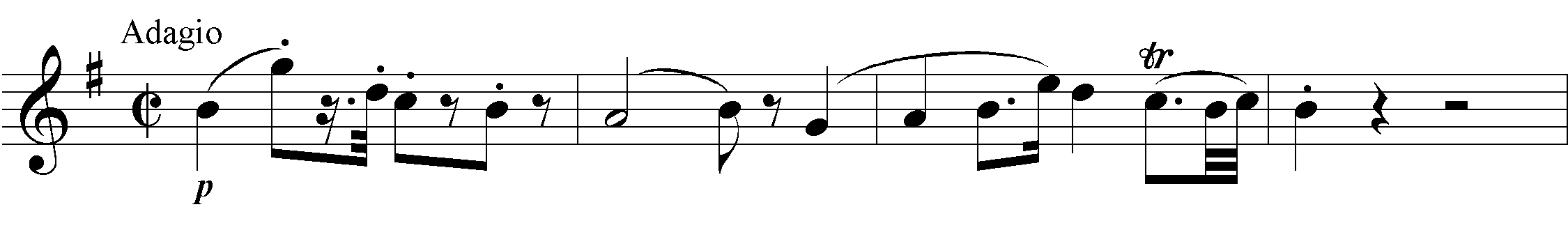
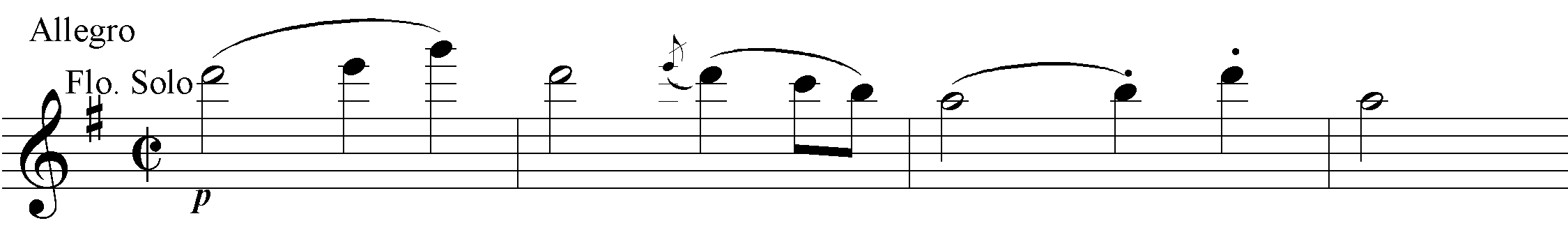
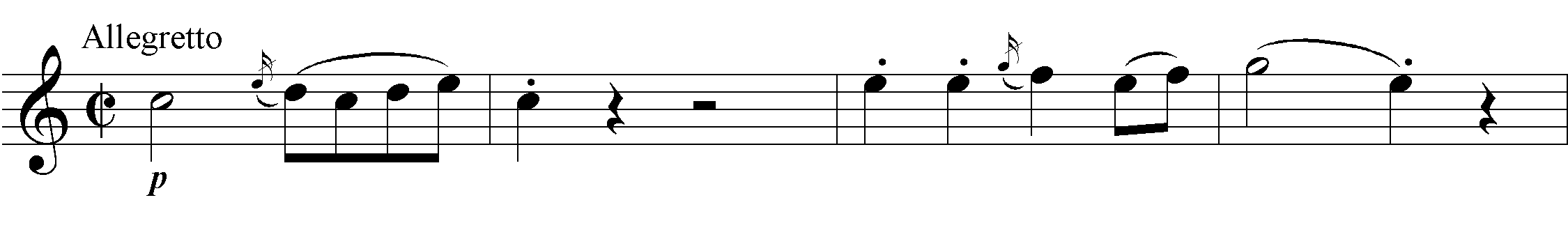
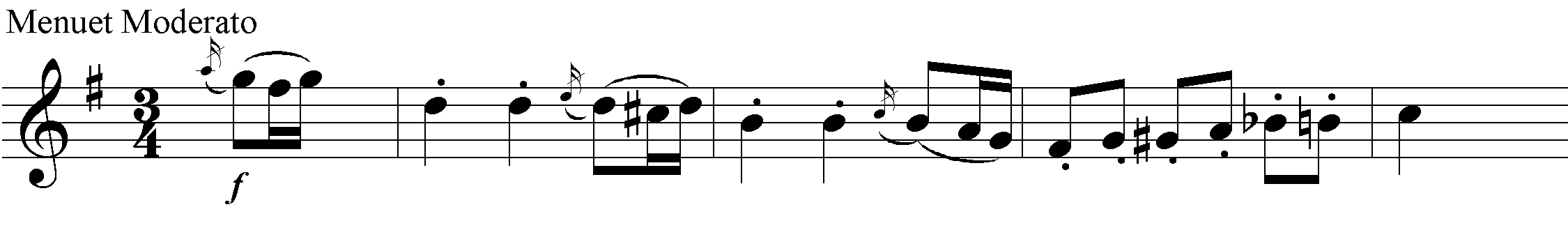
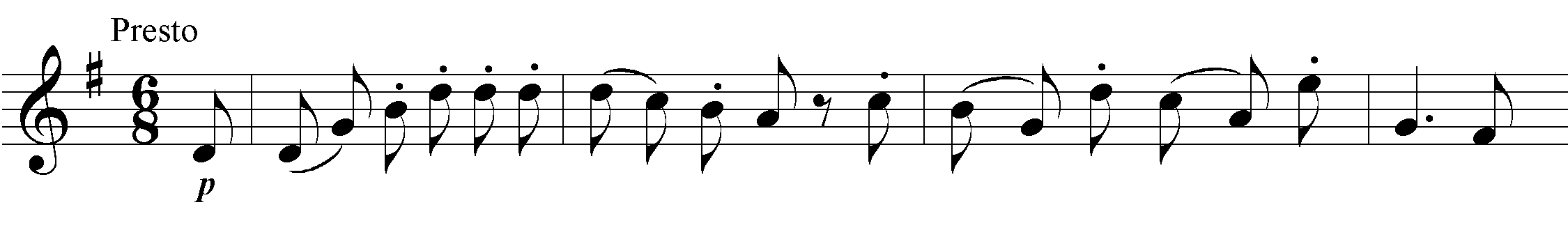
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)