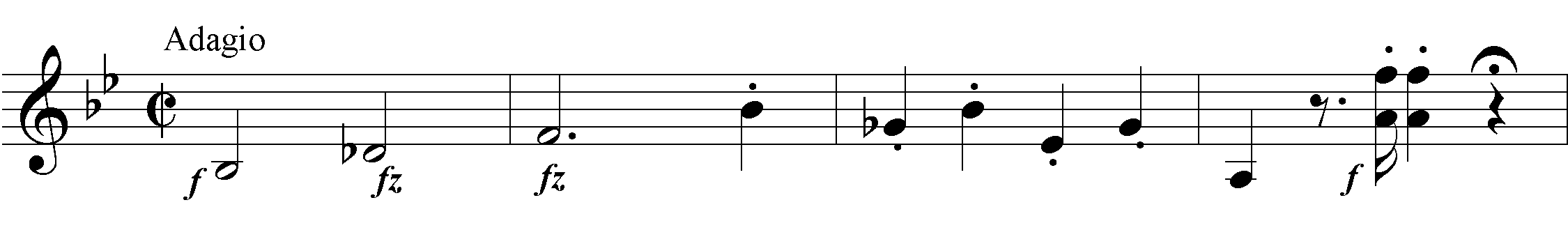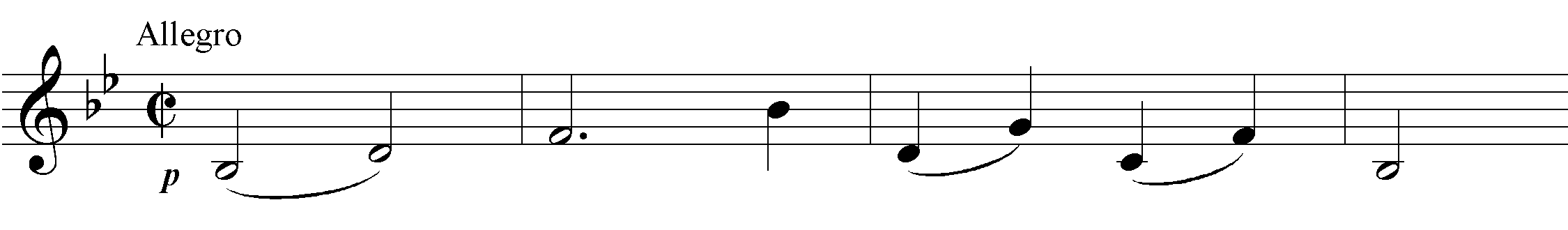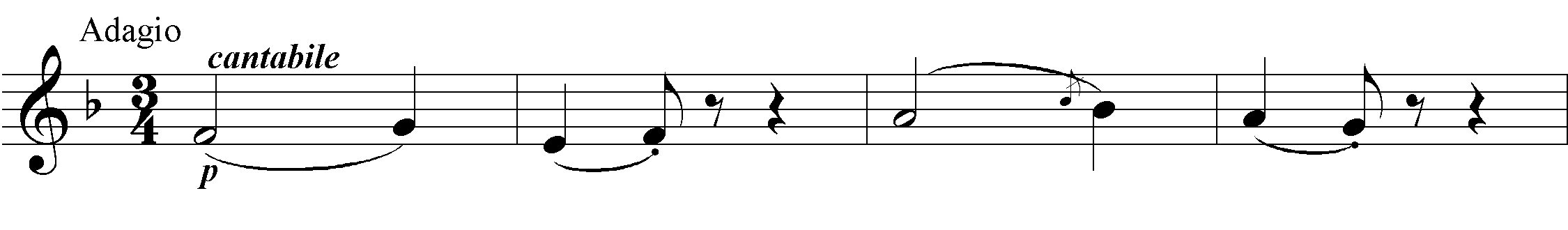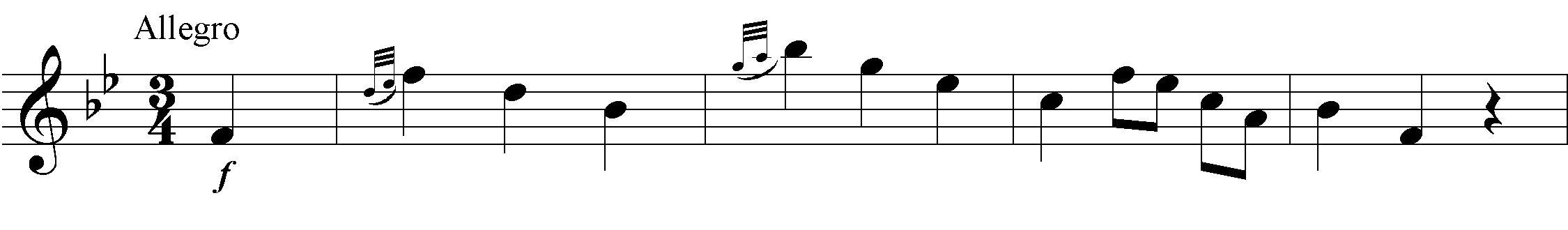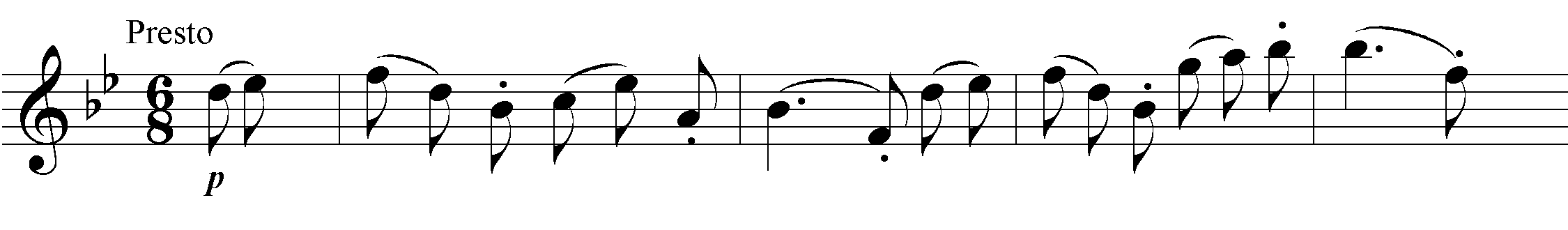98
B-Dur
Londoner Sinfonien, 2. Folge
Herausgeber: Robert von Zahn; Reihe I, Band 16; G. Henle Verlag München
Hob.I:98 Symphonie in B-Dur
Die Symphonie Nr. 98 wurde 1792, während des ersten Londoner Aufenthalts, komponiert und dort am 2. März 1792 im Rahmen des Dritten Salomon-Konzerts der Saison in den Hanover Square Rooms zum ersten Mal aufgeführt. Diese Komposition erfreute sich noch zu Lebzeiten Haydns eines außerordentlich hohen Bekanntheitsgrades. Die Originalpartitur, zeitweilig im Besitz Beethovens, dann in der Preußischen Staatsbibliothek Berlin, befindet sich nun in einer russischen Sammlung.
Im ersten Satz versucht Haydn die langsame Einleitung stärker als bisher in den Gesamtzusammenhang des Kopfsatzes zu integrieren: Die Einleitung beginnt in b-Moll mit einem Dreiklangsthema, das zuerst in abgesetzten, dann in gebundenen Noten vorgeführt wird und sich als Hauptthema des Vivace-Hauptteils herausstellt. Dieser, in dem beide Artikulationsvarianten des Themas Verwendung finden, geht weit hinaus über alles, was Haydn in früheren Symphonien (auch in den “Pariser Symphonien”) an kompositorischer Eleganz, kontrapunktischem Können und Kombinationsgabe, und dies alles in der selbstverständlichsten Weise, die man sich deneken kann, demonstriert.
Der zweite Satz beginnt choralartig mit zwei Verszeilen, die an das “God save the King” anklingen. Die Passagen, die sich daran anschließen und zu einem krisenhaften Kulminationspunkt geführt werden, sind ganz ohrenfällige Paraphrase eines Abschnitts aus dem langsamen Satz von Mozarts “Jupiter”-Symphonie. Man hat diesen Satz mit Recht als eine Trauermusik auf Mozarts Tod angesehen: Haydn hatte, als er in London Ende 1791 vom Tod Mozarts erfuhr, in einem Brief geschrieben: “Ich war über seinen Tod eine geraume Zeit ganz außer mir und konnte es nicht glauben, dass die Vorsicht [Vorsehung] so schnell einen unersetzlichen Mann in die andere Welt fordern sollte.”
Nach dem überraschend alpenländisch-derben Menuett gibt es am Schluss des vierten Satzes unvermuteterweise eine kleine Solo-Passage für das Cembalo, d.h. für den Komponisten des Werks selbst. (Es ist heute nicht mehr üblich, Haydns “Londoner Symphonien” so aufzuführen, wie es bei den “Salomon-Konzerten” geschah: nämlich mit obligatem Cembalo, und zwar dem Komponisten selbst am Instrument, der zwar nicht immer “mitspielte”, aber von dort aus seine Direktiven gab.) Diese “Selbstinszenierung” des Komponisten am Schluss des Werks ist jedoch Gegenstand eines subtilen musikalischen “Gags”: Der Schlusssatz, vom Typ her eines der Haydnschen “Jagd”-Finali, läuft zunächst 327 Takte lang in rasantestem Sechsachteltakt bis an sein “formales” Ende, dem zweiten Wiederholungszeichen, ab, aus Gründen des Tempos keine Sechzehntelnoten-Passagen zulassend. An dieser Stelle macht das Orchester eine rhetorische Kunstpause und setzt danach “più moderato” in deutlich gemächlicherem Tempo mit dem Hauptsatz, dessen Achtelnoten nun sehr abgezirkelt und künstlich wirken. Ein ausdrücklich vorgesehenes großes Crescendo des ganzen Orchesters führt zu einem weiteren Generalpausen-“Doppelpunkt”, nach welchem der am Cembalo sitzende Orchesterleiter nun mit seinem Instrument einsetzt und, den Rest des Werks mit einfachen Sechzehntelfigurationen begleitend, die Symphonie zu Ende bringt. Hat man es hier mit einer Selbstpersiflage des Komponisten-Dirigenten zu tun? Erweist das Orchester nur auf solche Weise seinem Leiter seine Reverenz, dass es die Passagen, bei denen er seine Cembalo-Kunst zeigen will, gemächlicher nimmt, damit dieser - “Papa Haydn” in persona - im Tempo mitkommt? Die etwas puppenhaft-konvulsivischen “Schlussverbeugungen” des Orchesters lassen dies vermuten. Jedenfalls ist leider nicht überliefert, ob das Publikum am Ende des Werks am Hanover Square herzlich gelacht hat.
Analyse

Analyse der Sätze
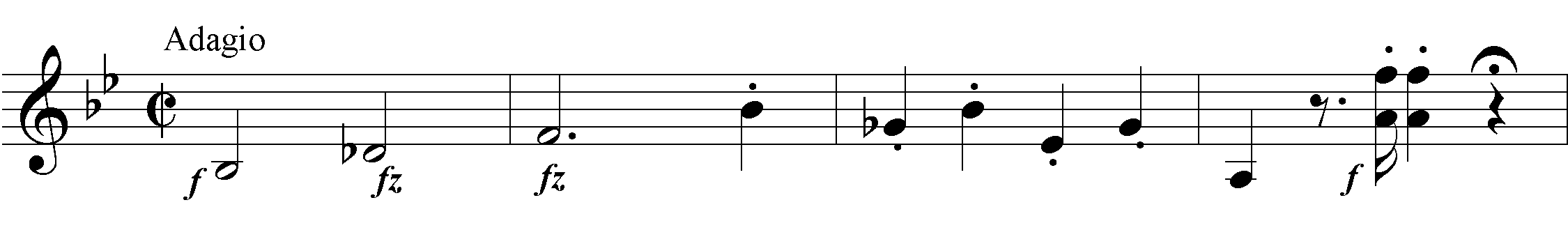
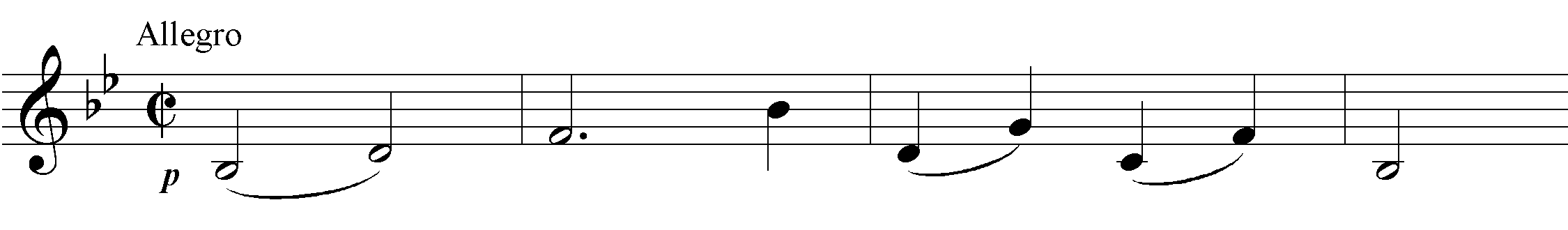
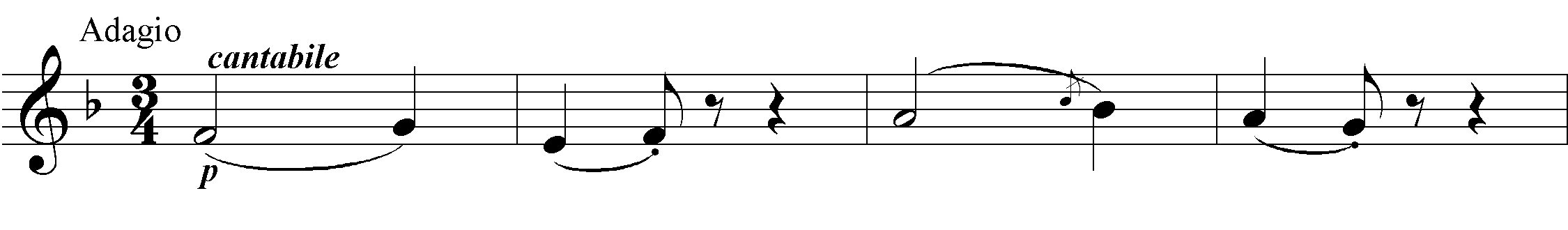
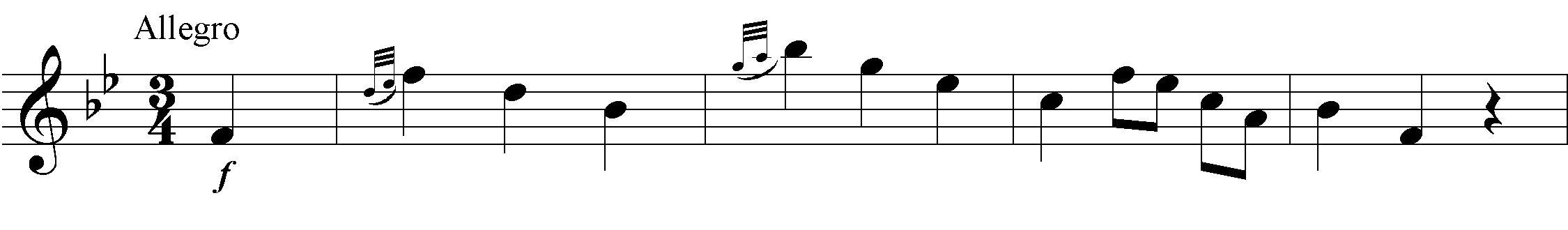
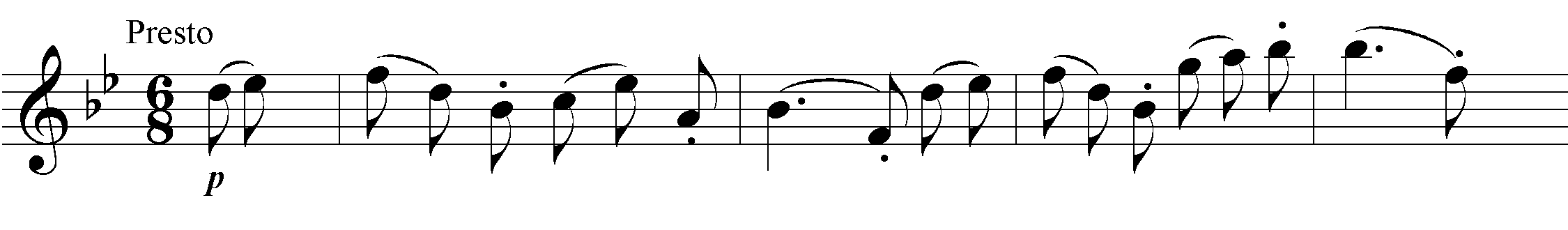
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)