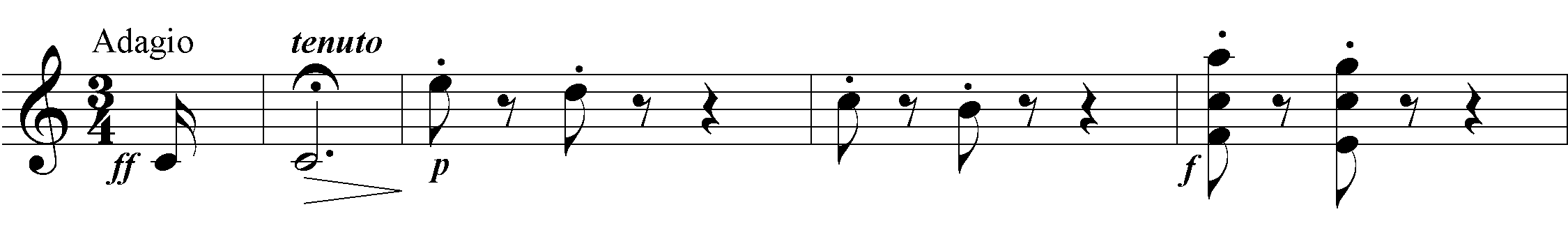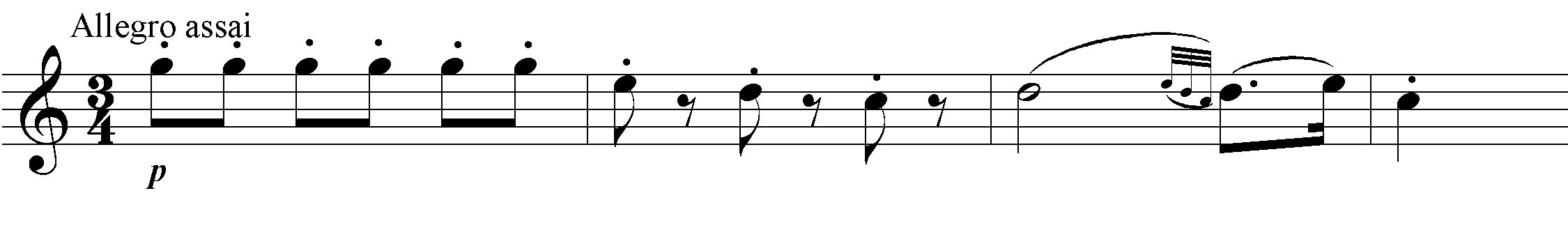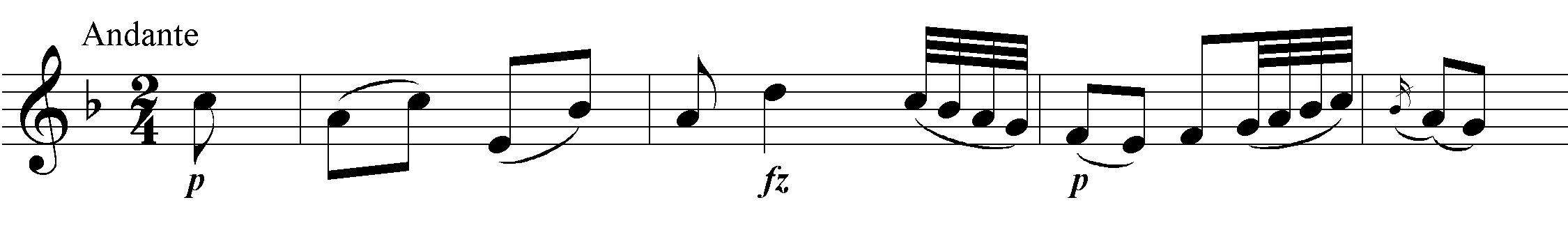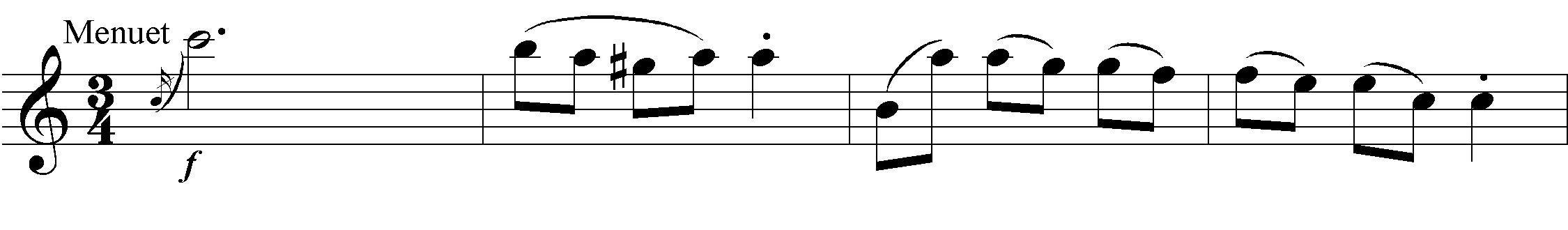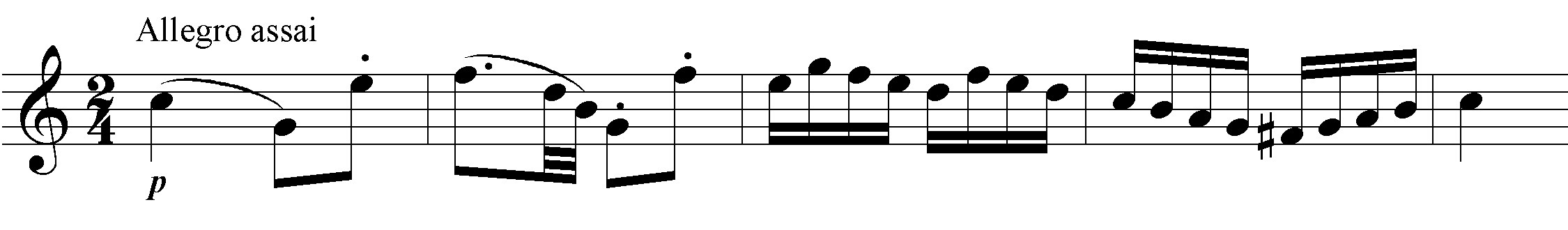90
C-Dur
Sinfonien 1787-1789
Herausgeber: Andreas Friesenhagen; Reihe I, Band 14; 2010, G. Henle Verlag München
Hob.I:90 Symphonie in C-Dur
Auch diese Symphonie wurde 1788/89 im Auftrag der Pariser Loge Olympique, sozusagen als Nachbestellung der sechs “Pariser Symphonien” Nr. 82-87 geschrieben und ist, wie auch Nr. 91 und 92 dem Auftraggeber Comte d'Ogny, zugeeignet. Gleichzeitig hat Haydn als tüchtiger Geschäftsmann diese Symphonien auch dem Fürsten Oettingen-Wallerstein verkauft, der ein glühender Haydn-Verehrer war und bei Haydn Symphonien in Auftrag gab. (Auf die Frage, warum der Fürst nur Kopisten-Abschriften erhalten habe, rechtfertigte sich Haydn, ein Augenleiden habe ihn daran gehindert, eine eigenhändige Reinschrift zu liefern.)
Nr. 90 und Nr. 91 stehen ein wenig im Schatten der berühmten “Oxford”-Symphonie Nr. 92 - was die C-Dur-Symphonie Nr. 90 betrifft, keineswegs zu Recht. Grundsätzlich weisen alle unmittelbar vor der Londoner Zeit geschriebenen Symphonien bereits die souveräne Durchgestaltung allen formalen Details auf, eine äußere Simplizität bei komplexer innerer Struktur.
Das Hauptthema des ersten Satzes ist eigentlich nur eine unscheinbare Kadenzfloskel, die als solche in der langsamen Einleitung bereits vorweggenommen und dann mit kühnem Kunstgriff “zweckentfremdet” an die Spitze des schnellen Hauptteils gesetzt wird. Hier ist zum ersten Male in der Geschichte der Symphonie der Versuch gemacht, langsame Einleitung und raschen Hauptteil miteinander zu verschränken. Die Tonrepetitionen, die den Kopf dieses Themas bilden, durchziehen gleichsam alles beherrschend den ganzen Satz, kontrapunktiert nur durch einen synkopisch geprägten Einwurf und unterbrochen von einem figurativ-spielerischen Seitenthema, was alles zusammen eine äußerst plastische Satzgestaltung ergibt. Am Schluss des Satzes kehrt das Hauptthema zu seiner Funktion als Kadenzformel zurück.
Der zweite Satz weist eine hohe formale Eigenwilligkeit auf: zwei kontrastierende, in Dur und Moll stehende Formteile, die in einer Art Doppelvariation abwechselnd weiterentwickelt werden. In einer der Variationen darf die Flöte Solo-Instrument spielen.
Beim Finale, einem rasanten und mit Kunststücken aller Art gespickten monothematischen Sonatensatz, nimmt die Coda, der Schlussteil, ein ganzes Drittel des Satzes ein. Beim Beginn dieser Coda wagt Haydn einen besonders kühnen “Gag” - einen jener Überraschungseffekte, deren man bei ihm stets gewärtig sein muss. Was es ist, wird hier nicht verraten: Wenn es ein Dirigent darauf anlegt, fällt auch ein Wiener Musikvereins- oder Salzburger Festspielpublikum auf Haydns Symphonieschluss herein, und das sogar zweimal unmittelbar hintereinander, wenn der zweite Teil des Finales - wie vorgeschrieben - wiederholt wird!
Analyse

Analyse der Sätze
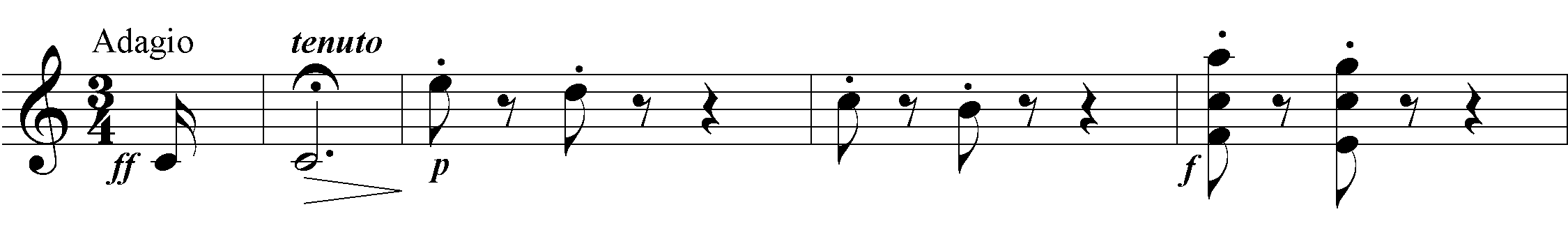
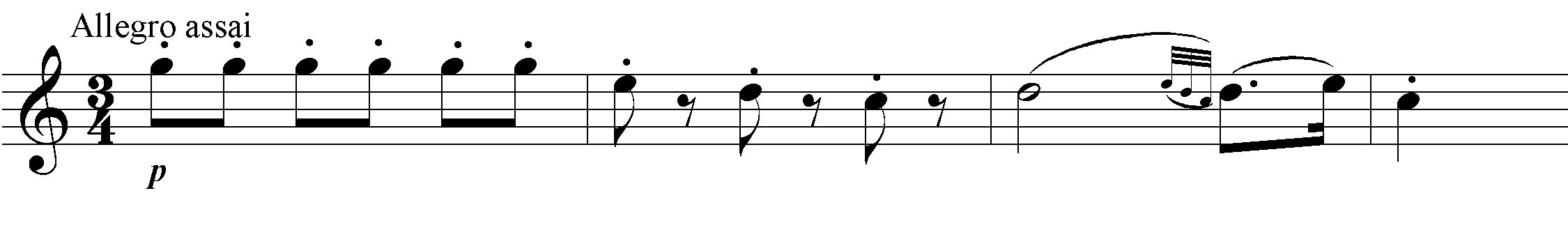
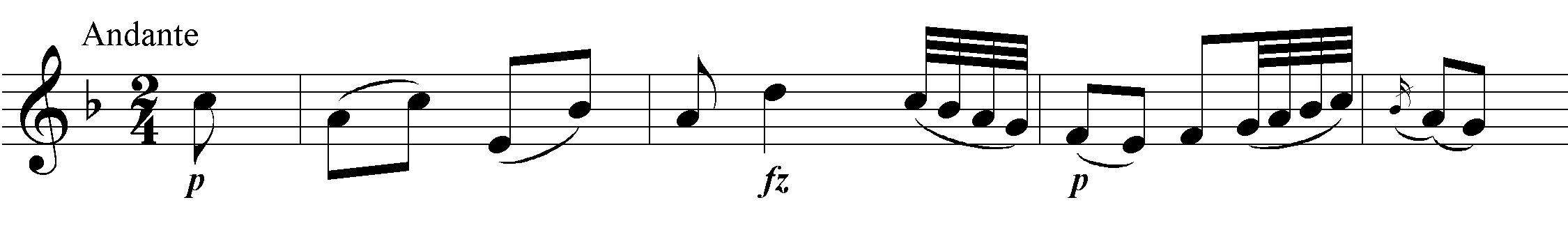
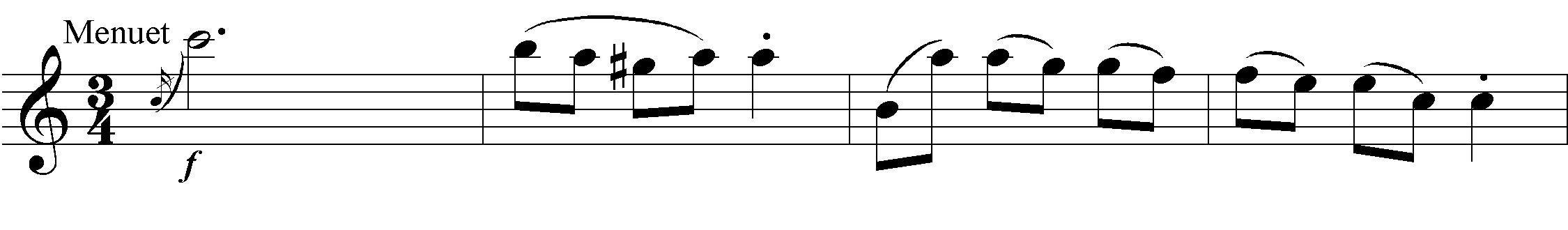
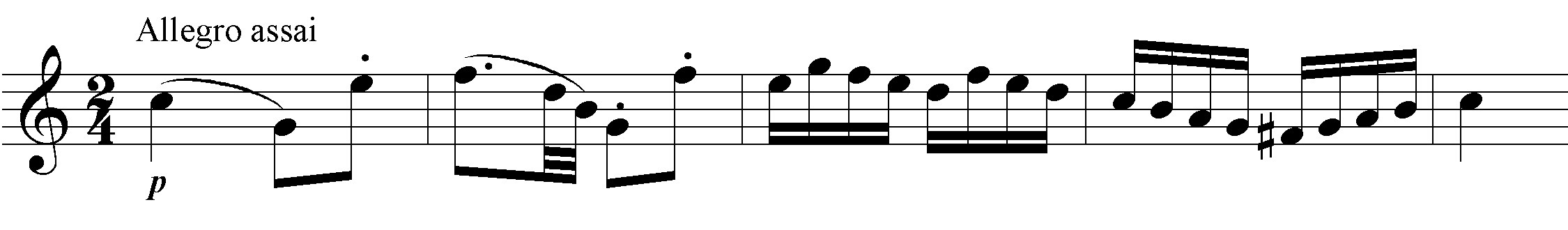
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)