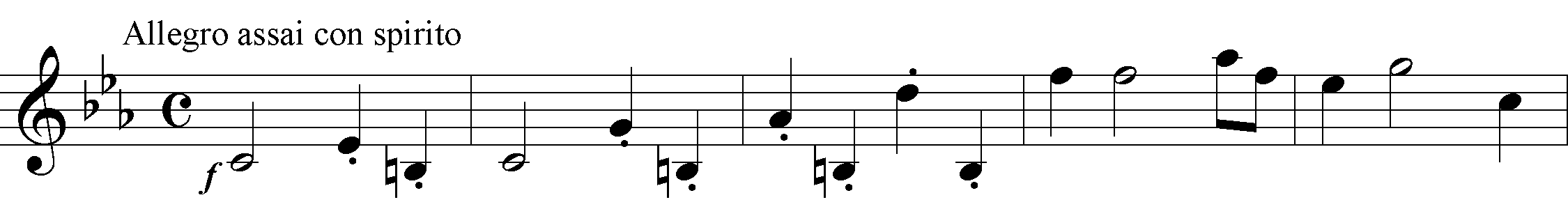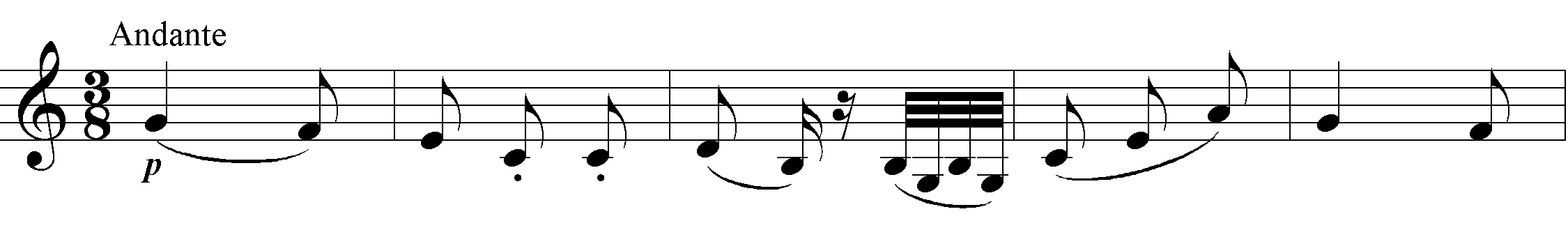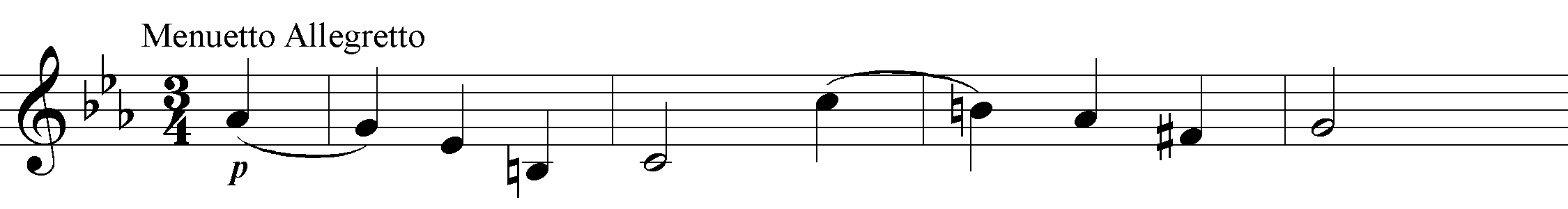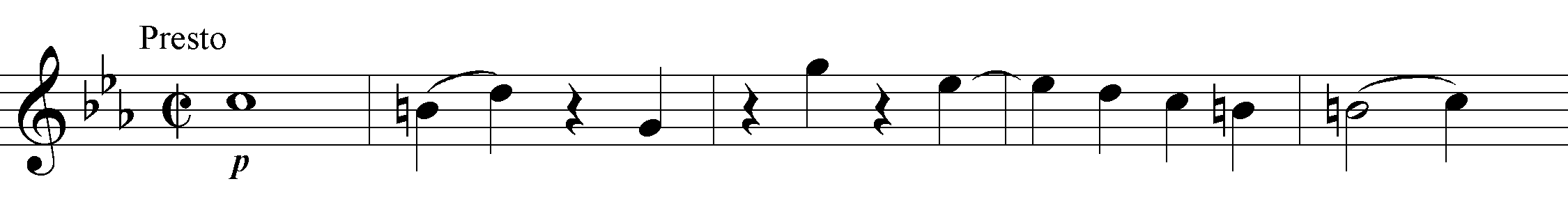52
c-Moll
Sinfonien um 1770-1774
Herausgeber: Andreas Friesenhagen und Ulrich Wilker; Reihe I, Band 5b; 2013, G. Henle Verlag München
Hob.I:52 Symphonie in c-Moll
Die Symphonie Nr. 52 ist ein außergewöhnliches Werk, dessen ausdrucksstarke Intensität zeitweilig der "Abschiedssymphonie" gleichkommt. Das Allegro assai con brio eröffnet mit einem ungestümen, unregelmäßigen Unisonothema. Die lange, variierte zweite Themengruppe umfasst sechs Abschnitte, von denen der dritte und fünfte das "zweite Thema" (das beim zweiten Auftreten noch mehr ausgedehnt wird) zweimal vorstellen. Dieses einzigartige Merkmal findet sich nur bei Haydn. Der restliche Teil ist ebenso stürmisch und instabil wie der Anfang. In der Durchführung sind die Kontraste zunächst weit weniger stark ausgeprägt. Schließlich führt eine längere Fortepassage zu einer "falschen Reprise" in der Subdominante f-Moll.
Das Andante in Sonatenform scheint zunächst bezugslos in seinem Kontext zu stehen: es ist ein rhythmisch schwungvoller 3/8 Takt in C-Dur, dessen gemächlich dahinfließendem Hauptthema es sogar erlaubt ist, mit seiner Eröffnungsphrase zu enden. Aber der Übergangsteil tritt ganz abrupt mit einem Forte auf und fährt mit einer ganzen Reihe von unerwarteten und teilweise destabilisierenden Kontrasten fort. Die nachfolgende lange zweite Themengruppe erscheint nach außen hin gemessen; dem Hörer werden jedoch die subtile Chromatik und die unregelmäßigen Phrasierungen auffallen. Die Durchführung besteht aus zwei Teilen: Der erste ist forte und modulierend, während der zweite auf die Paralleltonart a-Moll bezogen ist. Eine seltsam indirekte Überleitung führt zu einer vollständigen Reprise.
Nun folgt ein ausgezeichnetes Beispiel für diesen Hauch von "Exotik", den man bei Haydn häufig in Menuett- und Triosätzen in Moll findet. Trotz der vorherrschenden Pianodynamik, übt er einen unangenehmen Zwang aus. Durch die Durtonart mag das Trio in erster Linie als ein Kontrast erscheinen; es basiert jedoch auf demselben Motiv wie das Menuett, mit dem es auch die tiefere Lage und eine gewisse unregelmäßige Phrasierung gemein hat.
Das Prestofinale greift die Instabilität des ersten Satzes auf, allerdings in unterschiedlicher Art und Weise. Es beginnt mit einem sparsamen, kontrapunktischen Thema, dessen Pianodynamik nicht nur durch das Gegenthema und die Überleitung aufrechterhalten wird, sondern auch durch den langsamen Anfangsabschnitt der zweiten Themengruppe. Sobald schließlich ein Forte hervorbricht, wird der restliche Teil der zweiten Gruppe unbarmherzig in Richtung Schlusskadenz vorangetrieben. Die zweite Hälfte ist ein verblüffendes Beispiel für eine verschmolzene Durchführung und Reprise. Auch sie beginnt mit einem langen Pianoabschnitt (der auf dem zweiten Thema basiert). Das nachfolgende kurze kontrapunktische Forte führt zu einer Wiederaufnahme des Pianoanfangsthemas. Allerdings geschieht dies viel zu früh, so dass es sehr schnell wieder zu der kontrapunktischen Musik zurückführt, der nun die Rolle einer "zweiten Durchführung" zukommt. Dies führt überraschend zu dem letzten Forteabschnitt der Exposition, und erst nach einer Ausdehnung und Pause auf einem dissonanten Akkord kehrt das lang verschollene zweite Thema in der Tonika wieder. Auch dieses Thema kann nicht kadenzieren. Nur eine abrupte Reihe von synkopierten Akkorden, die in einem schockierenden "stillen" Takt gipfeln, kann einen eindrucksvollen Abschluss herbeiführen.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
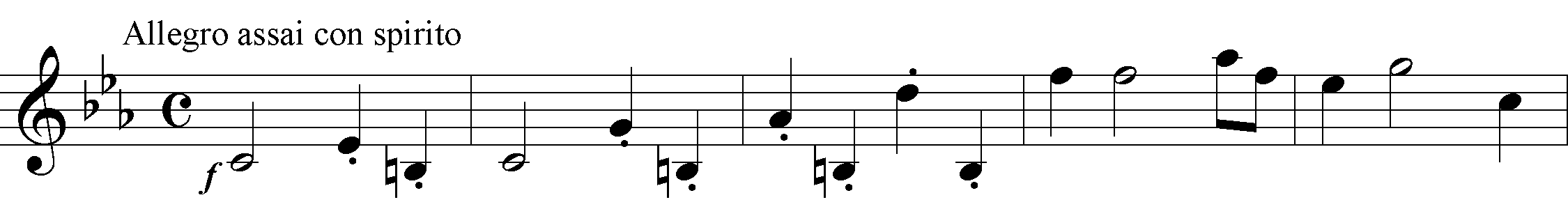
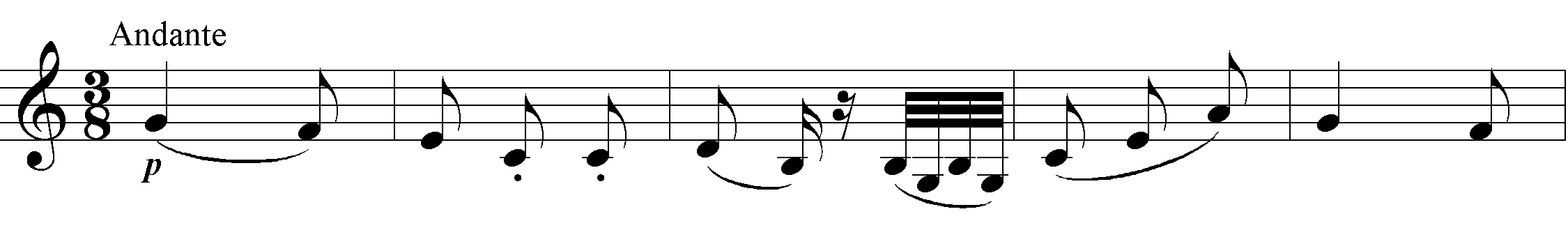
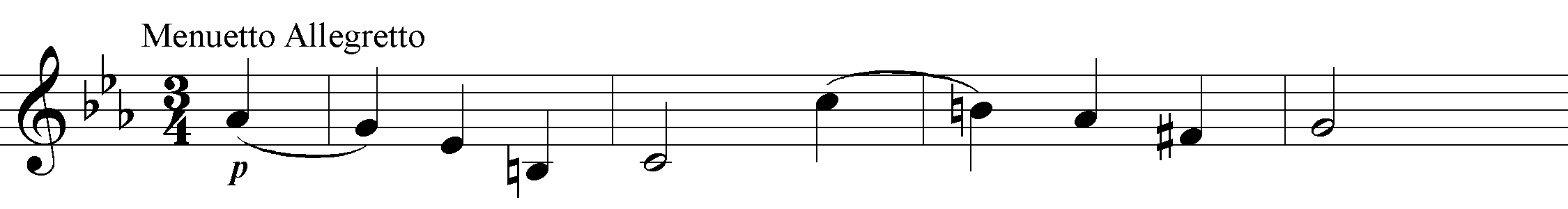
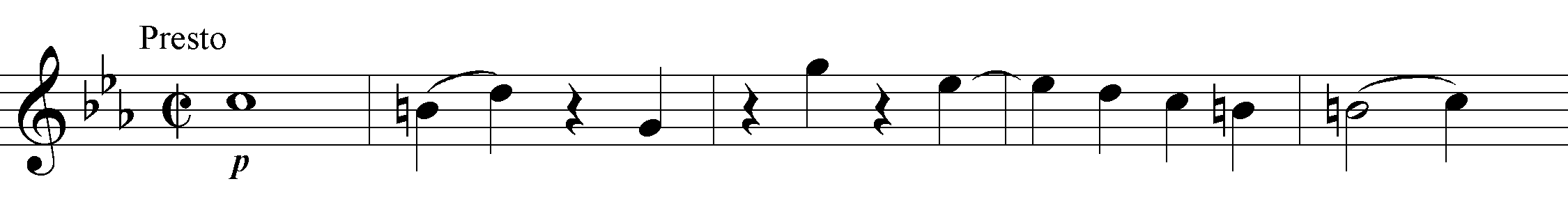
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)