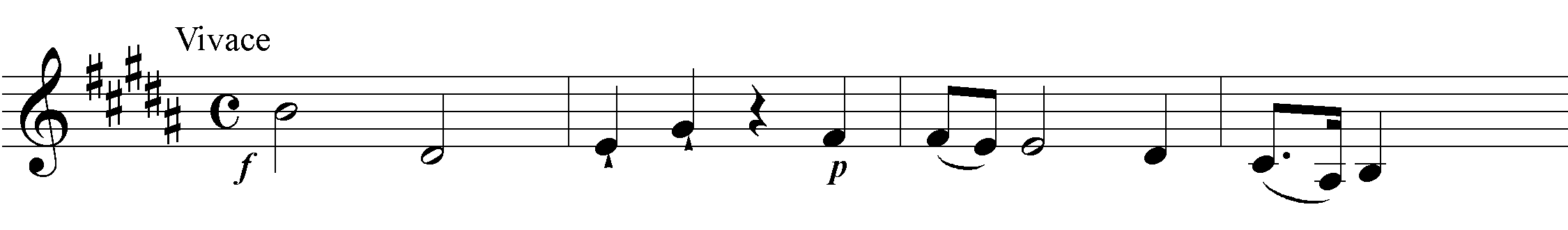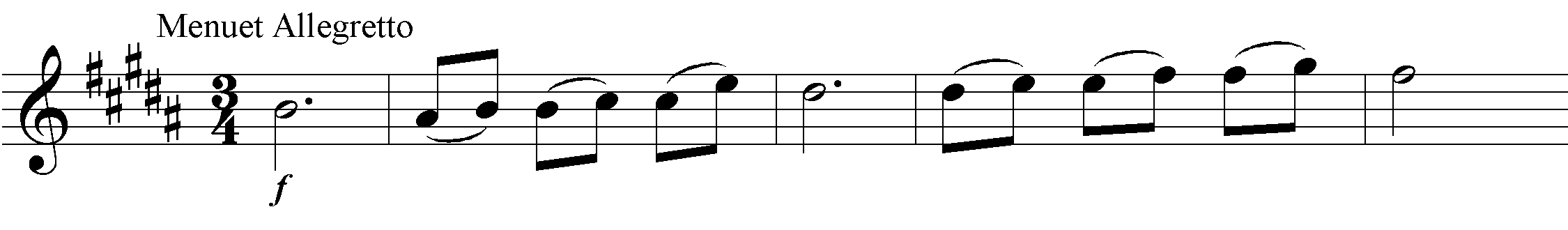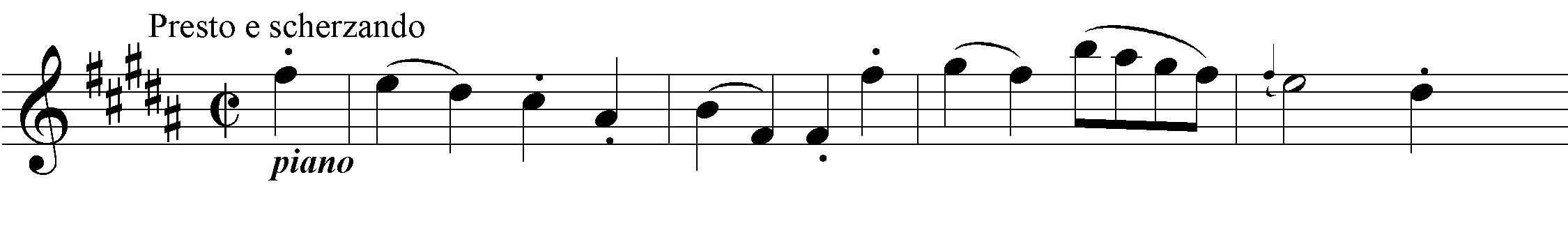46
H-Dur
Sinfonien 1767-1772
Herausgeber: Carl-Gabriel Stellan Mörner; Reihe I, Band 6; G. Henle Verlag München
Hob.I:46 Symphonie in H-Dur
Diese Symphonie ist in vielerlei Hinsicht ein Gegenstück zu der "Abschiedssymphonie". Auch sie steht in einer ungewöhnlichen Tonart. Viel wesentlicher ist jedoch, dass sie sinfonische Konventionen sprengt. Nach einem komplexen Anfangsvivace, einem verschwörerischen Poco adagio in h-Moll und einem scheinbar galanten Menuett, bricht das Presto Finale gegen Ende für eine lange Reprise des Menuetts ab, beginnt schließlich wieder und schließt den Satz ab.
Das Menuett beginnt mit kraftvollem Forte und fährt auch so nach dem Doppelstrich fort. Die Reprise ist allerdings (wie so oft in Haydns Menuetten) abgewandelt. Die Bläser ziehen sich zurück, und die Dynamik wechselt zu piano; die anfängliche Viertelpause im Bass wird auf mehr als einen Takt ausgedehnt, und in diese Stille kehrt die Anfangsphrase in freier Krebsgestalt wieder: ein "ersterbendes Absinken". Außerdem läuft diese Reprise in der Dominante ab und schafft damit eine progressive, asymmetrische Form für das Menuett insgesamt. Das Trio in h-Moll beschwört eine "exotische" Atmosphäre durch nicht funktionale Progressionen, eine Anhäufung von harmonischen, instrumentalen und dynamischen Überraschungen und eine mehrdeutige Tonalität. Die Melodie (so wie sie ist) könnte bis zu den letzten beiden Takten entweder in h-Moll oder D-Dur korrekt harmonisiert werden.
Nach außen hin ist das Finale typisch für die damalige Zeit. Der Anfang ist jedoch "schwach": er ist nur für Violinen geschrieben und projiziert den Tonikadreiklang in die erste Umkehrung (über dis) statt in Grundstellung. Er ist auch rhythmisch unbeständig und für ein Finalthema ungewöhnlich ruhig. Vermutlich bezieht sich die Überschrift "scherzando" unter anderem auch auf diese Merkmale. Die sehr kurze Durchführung ist in der Dominante der verwandten Molltonart und der Mediante zentriert, die beide ebenfalls auf dis aufgebaut sind. Und die Reprise bricht — erneut auf der Dominante — ab, ehe sie die strukturbildende Kadenz erreicht.
Daraus kann man folgern, dass die Wiederkehr des Menuetts ebenfalls auf der Dominante, mit der Reprise eines Binnenmotivs des Menuetts beginnt. Da man den Anfangsabschnitt des Menuetts nicht hört, hebt die Wiederkehr seine progressive Seite noch mehr hervor. Ein Trugschluss führt schnell zu einer erneut instabilen Dominante und einer Fermate. Plötzlich bricht im Forte das harmonisierte Presto als Kopfmotiv heraus — diesmal in V-I-Kadenz in Grundstellung. Eine solche Verbindung gibt es sonst nirgendwo in diesem Satz. Danach folgt das "fehlende" Ende der Reprise, das mit einem anhängenden Motiv vergrößert und wiederholt wird und allmählich erstirbt. Damit ist die Coda mit ihrem Orgelpunkt in den tiefen Hörnern nicht nur ein guter Scherz ganz im "scherzando" Stil, sondern sie schafft ein Minimum an Bestätigung der wiederbestätigten Tonika.
Warum verzichtet das Menuett auf einen eigenen Anfang? Welchen Sinn hat es, es im Finale ins Gedächtnis zurückzurufen und diese zwei Sätze in einem durchkomponierten Gebilde zu verbinden? Welche Rolle spielt dieser Bruch in der Symphonie insgesamt?
Das Melodiematerial des Menuetts basiert größtenteils auf einer zweitönigen Appoggiatura, d.h. einem "Seufzer"-Motiv. In der Reprise treten die Seufzer jedoch in den Vordergrund und führen zu dem schon erwähnten "ersterbenden Absinken". Im Menuett ist diese Passage schon eine variierte Reprise. Im Finale ist damit der wiederkehrende Menuetteil eine Reprise "zweiter Ordnung", zwei Stufen von dem Originalmodell entfernt: Musik "über" eine Reprise. Ihr Inhalt ist keine Reprise im gewöhnlichen Sinne, sondern die Erfahrung, eine Reprise zu hören. Was die Gattung angeht, wirkt die Menuett-Reprise schockierend und unvorhersehbar. Am Anfang weiß man nicht, was gerade passiert und es dauert einen Moment, bis man sich zurechtfindet. Es ist also nicht nur ein Wiederkehren, nicht nur ein "ersterbendes Absinken", sondern eine Reminiszenz; ein neues Erfahren mit einem Anflug von Nostalgie oder Bedauern, das seine eigene Vergangenheit in seine klingende Gegenwart aufnimmt. Beim Hören erfahren wir, was es "war" — etwas, was wir bisher nicht kannten.
Haydns metamusikalische Reminiszenz vereinigt Vergangenheit und Gegenwart, Menuett und Presto in einer komplexen Darstellung dessen, was man als den zugrunde liegenden Gedanken der Symphonie Nr. 46 ansehen muss. Dieser Gedanke muss in seiner Beziehung zur "AbschiedsSymphonie" gesehen werden. Welche Reihenfolge beabsichtigte Haydn bei diesen zwei außergewöhnlichen Werken? Entstand die H-Dur-Symphonie später? Sollten die etwas vertrautere Tonart und das Durgeschlecht das in Eisenstadt wieder eingekehrte Leben vermitteln und soll das Finale soviel bedeuten wie "und sie lebten alle glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage"? Oder entstand sie doch als das frühere Werk? Spiegelt sie das Leben in Esterháza wider? Soll diese bittersüße Menuett-Reminiszenz an die glücklichen, geordneten Zeiten in Eisenstadt erinnern, die noch nicht wieder greifbar sind, was in der "AbschiedsSymphonie" durch eine unerträgliche Spannung zu einer Vision des sehnsüchtigen Verlangens führen wird? Die Wissenschaft kann diese Fragen nicht beantworten, aber es gibt keinen Grund, warum die Zuhörer kein Vergnügen daran finden sollten, darüber zu spekulieren.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
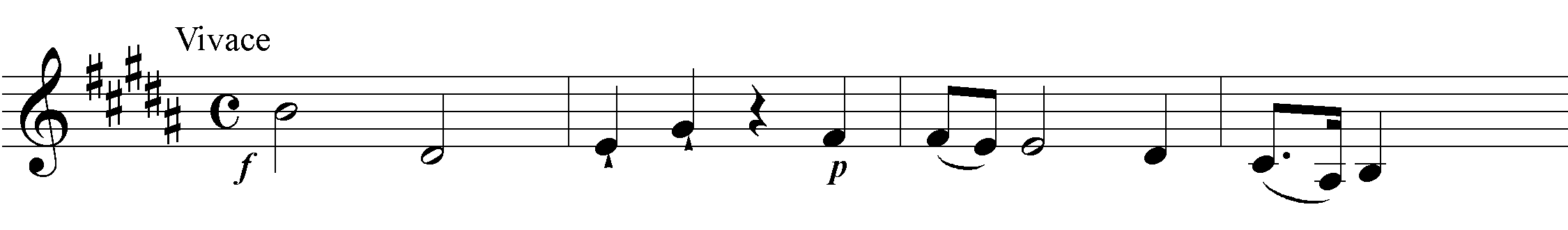

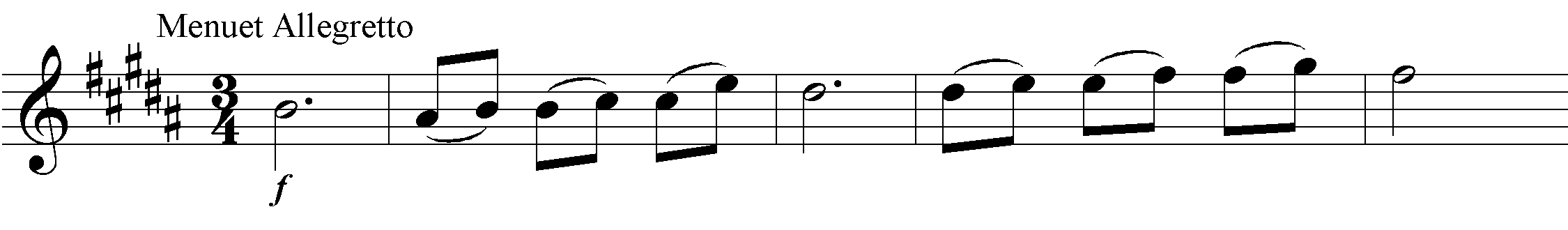
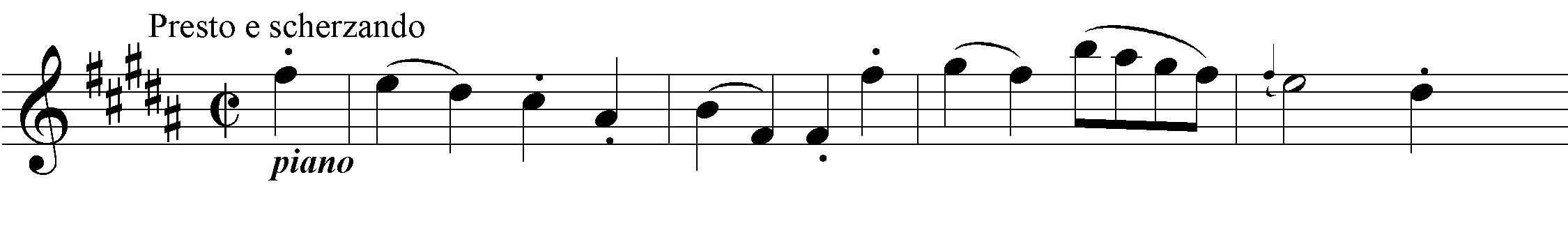
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)