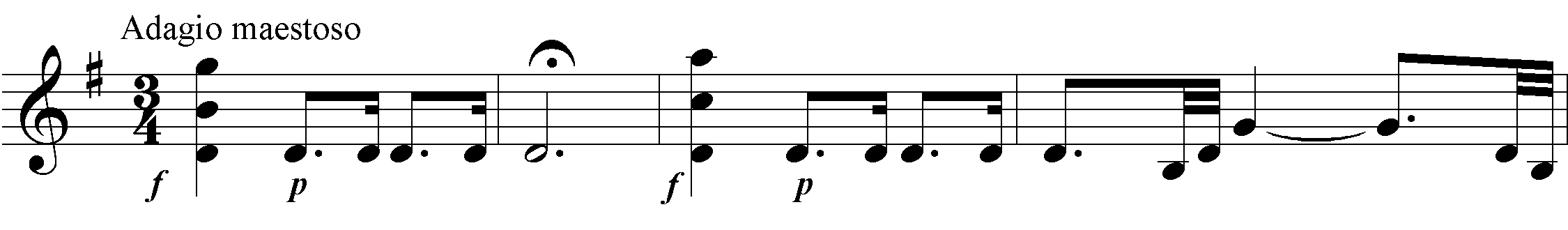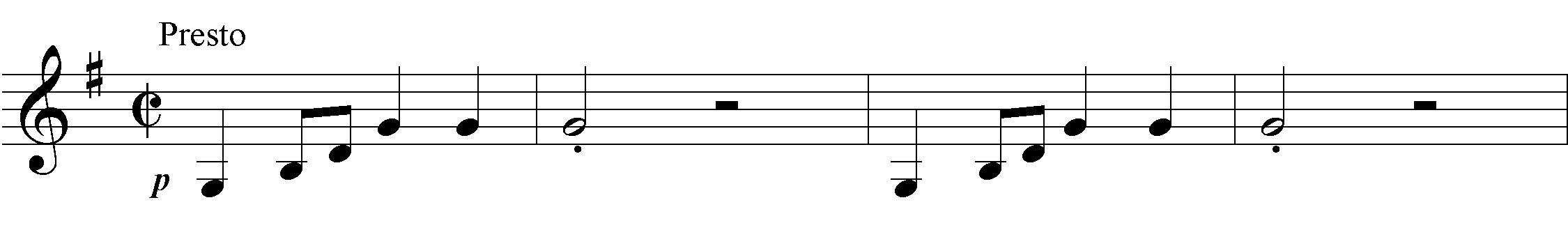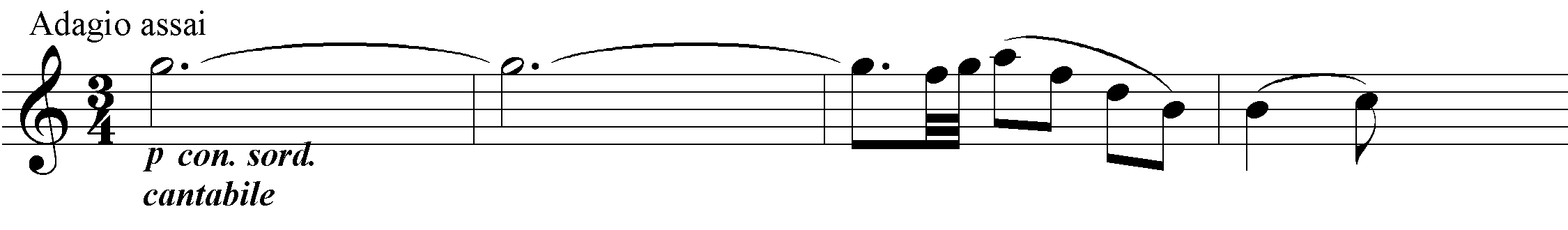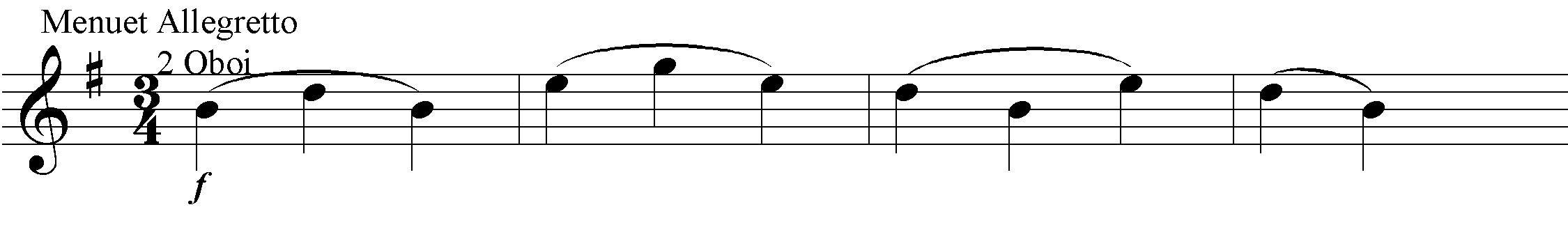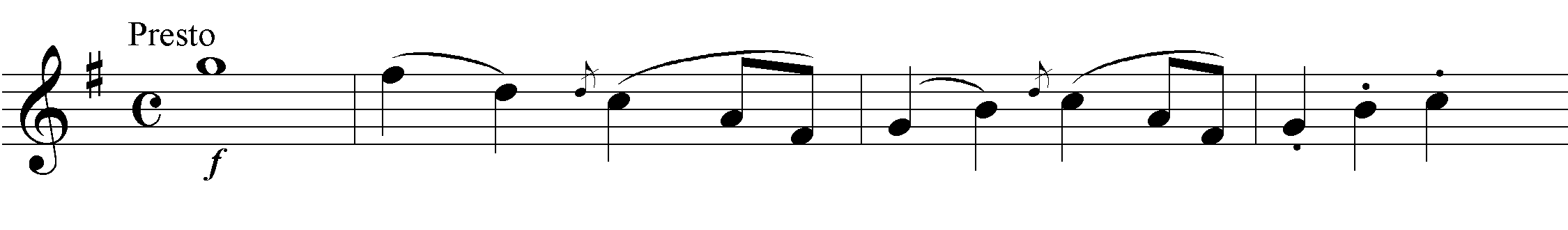54
G-Dur
Sinfonien 1773 und 1774
Herausgeber: Wolfgang Stockmeier; Reihe I, Band 7; G. Henle Verlag München
Hob.I:54 Symphonie in G-Dur (erste Version)
Das Hauptthema des einführenden Presto wird von den Hörnern und dem obligaten Fagott über einem Ostinato-Motiv der Streicher gespielt. Die Exposition ist kurz; die zweite Gruppe in der Dominante beginnt ohne Übergang und weist eine Reihe von kurzen, lebhaften Themen auf. Einen Ausgleich für diese Kürze liefert die Durchführung, die — für Haydn ungewöhnlich — länger ausfallt als die Exposition. Sie baut vor allem auf dem Ostinato-Motiv auf, das mehrere Tonarten durchläuft (darunter ein unerwartet strahlendes E-Dur); schließlich führt ein Fugato zur Rückführung, die — wiederum ungewöhnlich — den Höhepunkt des gesamten Durchführungsteils darstellt. Gegen Ende führt eine "überraschende" Scheinauflösung mit einem verminderten Septakkord zu einer erweiterten Kadenz.
Der folgende Satz ist als "Adagio assai" gekennzeichnet, ein für Haydn außergewöhnlich langsames Tempo; es mag sich hier durchaus um seinen längsten Instrumentalsatz überhaupt handeln. Solche tief empfundenen, sehr langen, vorwiegend ruhigen langsamen Sätze in Sonatenform entwickelten sich erstmals während der "Sturm- und Drangzeit" (z.B. in den Symphonien Nr. 44 und 48) zu einer Grundform bei Haydn; mitunter bevorzugte er sie auch Mitte der 70er Jahre; der vorliegende Satz liefert das beste Beispiel dafür. Die Triolenfiguration, manchmal imitatorisch, manchmal über statischen Harmonien verlaufend, wirkt mit der Zeit fast hypnotisch: eine entrückte Vision, die von den bedrohlichen, wiederholten Gleichklängen zu Beginn der Durchführung kaum gestört wird. Bei der Reprise wechselt diese Figur plötzlich in die Molltonart und führt überraschenderweise zu einem Quartsextakkord und einer voll ausgeschriebenen Kadenz für beide Geigenparts.
Danach wirkt das rustikale Menuett mit seinen unbekümmerten Verzierungen beinahe derb; der Effekt wird durch die ruhige Antwort nicht wirklich aufgehoben, denn Haydn schreibt für die Kadenz wieder forte vor. Im Gegensatz dazu ist das nur für Streicher orchestrierte Trio, bei dem das Fagott die Melodie verdoppelt, der Inbegriff der Eleganz.
Das Finale, obwohl ebenfalls als Presto ausgeschrieben, ist nicht so schnell wie der erste Satz. Es ist in einer breit angelegten Sonatenform gehalten, mit vollen Übergängen und sogar einem ruhigen, kontrastierenden Nebenthema. Das Eröffnungsthema hat eine schnelle, synkopierte Begleitung und endet ganz seltsam mit einem "Knall"; hier deuten sich die vielen ausgefallenen Akzente und längeren Synkopierungen der späteren Jahre schon an. Die Rückführung gilt als einer der besseren Scherze Haydns: Das zweite, ruhige Thema setzt in e-Moll ein, als wäre man noch mitten in der Durchführung; aber es wird mit einem chromatisch absteigenden Bass harmonisiert, der eine Grundsequenz mit absteigenden Quinten ausführt; fünf Takte später ist man plötzlich mitten in der Reprise.
Zweite Version
Wie in den historischen und chronologischen Anmerkungen ausgeführt, ist dies die letzte, sehr stark besetzte Fassung dieser Symphonie. Die Adagio-Einleitung ist ausgedehnter als zuvor und gestaltet den obligatorischen "majestätischen" Topos auf komplexe Art aus. Das Hauptthema des Anfangs-Presto hebt die Hörner und das obligate Fagott über einem Ostinatomotiv in den Streichern hervor. Die Exposition ist kurz; die zweite Gruppe in der Dominante setzt ohne Überleitung ein und bringt eine Reihe knapper, lebhafter Themen. Haydn gleicht dies in der Durchführung aus, die unüblicherweise ausgedehnter als die Exposition ist. Sie beruht in erster Linie auf dem Ostinatomotiv, das durch eine Reihe von Tonarten geführt wird, einschließlich eines unerwartet strahlenden E-Dur nach einer Generalpause; schließlich führt ein Fugato zur Rückführung, die erstaunlicherweise der Höhepunkt der ganzen Durchführung ist. Gegen Ende führt eine "Überraschungs"-Scheinauf-lösung auf einem verminderten Septakkord zu einer erweiterten Kadenz.
Das Adagio assai (ein ungewöhnlich langsames Tempo für Haydn) könnte sein längster Instrumentalsatz sein. Derartig ausgedehnte, tief empfundene, hauptsächlich ruhige langsame Sätze in der Sonatenhauptsatzform waren für Haydn erstmals im Verlauf der Periode seines "Sturm und Drang" zu einem "Typus" geworden. Die manchmal imitierend geführte und sich mitunter über statischen Harmonien erstreckende Triolenfiguration wird beinahe hypnotisch: eine jenseitige Vision, die kaum durch die bedrohlichen wiederholten Unisoni zu Beginn der Durchführung gestört wird. In der Reprise wendet sich diese Figur unerwartet nach Moll und führt erstaunlicherweise zu einem Quartsextakkord und einer ausgeschriebenen Kadenz für beide Violinstimmen. Das folgende rustikale Menuett mit seinen unbekümmerten Verzierungen scheint beinahe grob zu sein; die Wirkung wird nicht wirklich durch die ruhige antwortende Phrase zerstreut, da Haydn für die Kadenz ins Forte zurückfällt. Das nur mit Streichern und mit dem die Melodie verdoppelnden Fagott besetzte Trio ist im Gegensatz dazu von reiner Eleganz.
Obwohl das Finale gleichfalls als Presto bezeichnet ist, besitzt es kein so hohes Tempo wie der erste Satz. Das Anfangsthema weist eine schnelle synkopierte Begleitung auf und endet merkwürdigerweise auf einem Schlag: Diese Merkmale kündigen die vielen Akzente auf unbetonten Taktteilen und die längeren synkopierten Passagen an, die später zu finden sind. Der Satz steht in einer in großen Zügen angelegten Sonatenhauptsatzform mit vollständigen Überleitungen und einem ruhigen, kontrastierenden zweiten Thema. Die Rückführung besteht aus einem der besseren Späße Haydns: Das ruhige zweite Thema mündet in eine fremde Tonart, als würden wir uns noch tief in der Durchführung befinden; jedoch ist es mit einem chromatisch fallenden Bass harmonisiert, der sequenzierend in Richtung Tonika treibt; fünf Takte später befindet sich die Reprise plötzlich in voller Bewegung.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
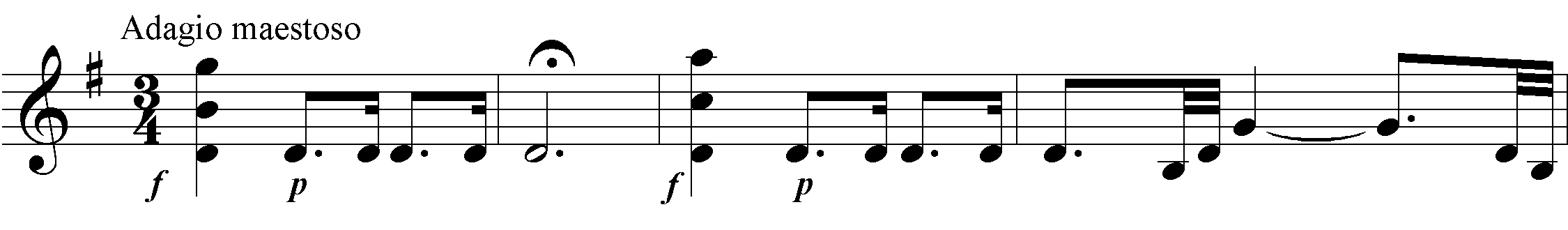
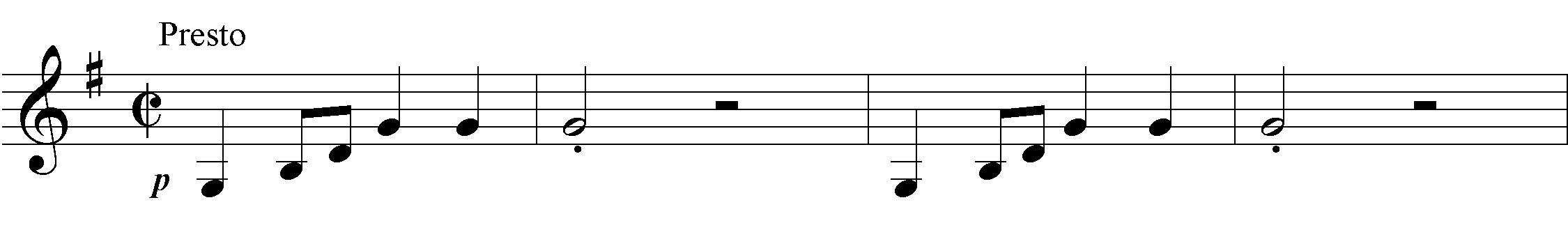
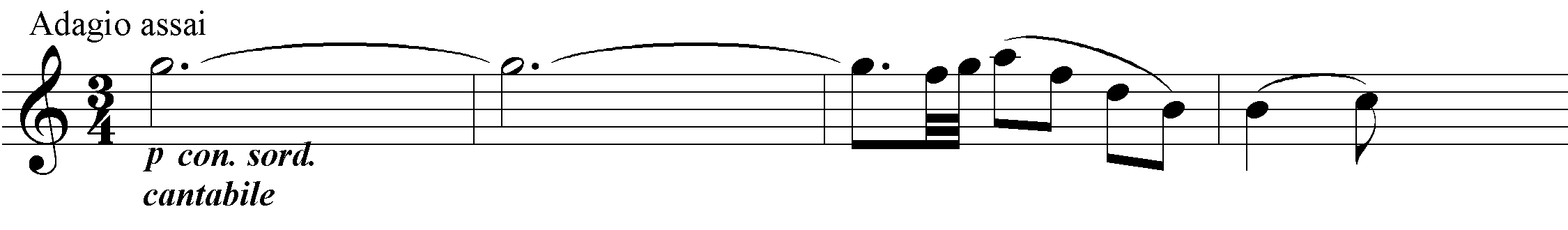
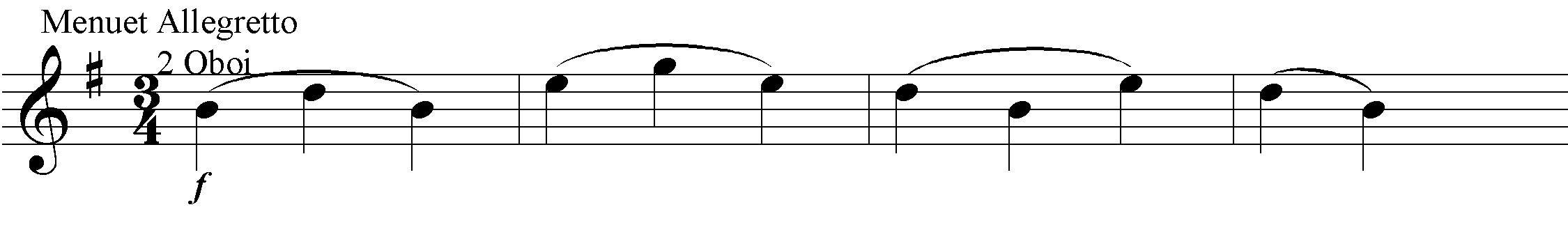
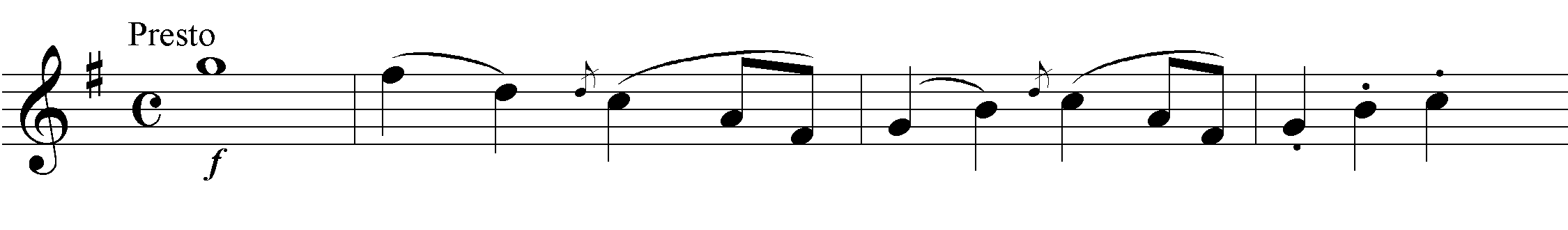
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)