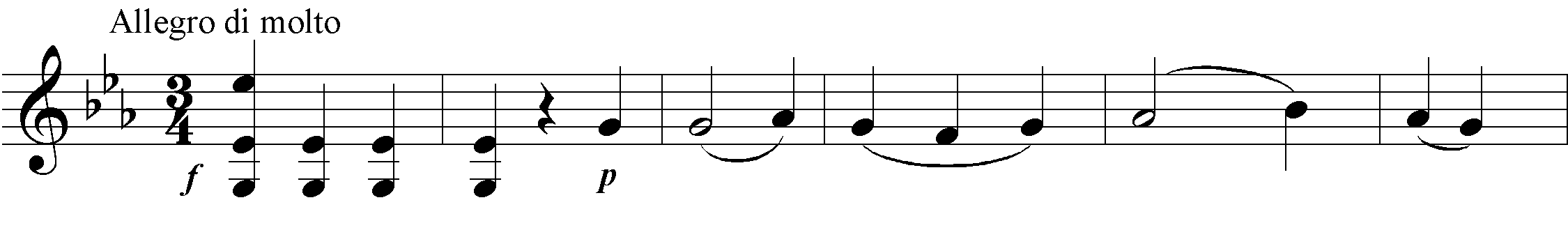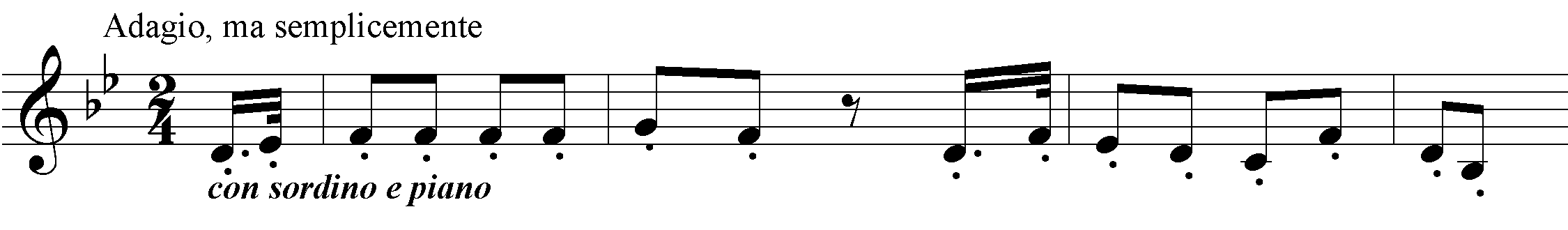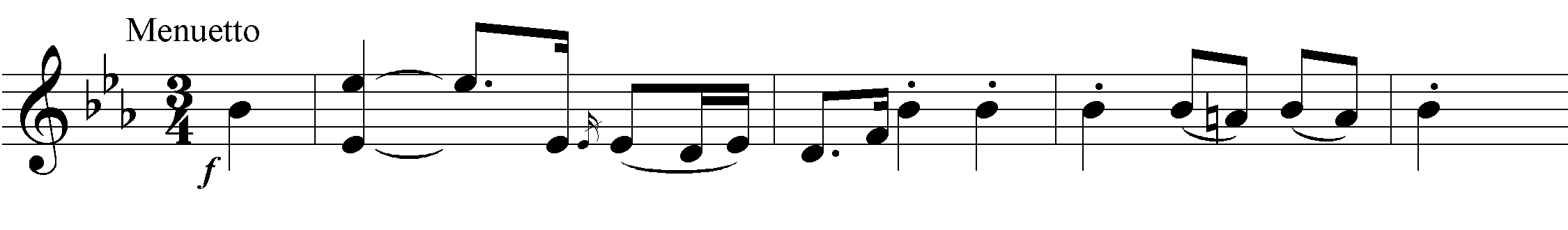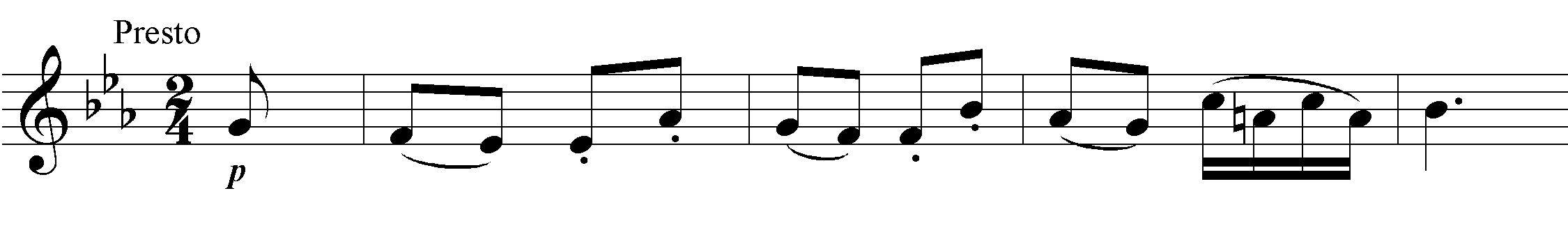55
"Der Schulmeister"
Es-Dur
Sinfonien 1773 und 1774
Herausgeber: Wolfgang Stockmeier; Reihe I, Band 7; G. Henle Verlag München
Hob.I:55 Symphonie in Es-Dur ("Der Schulmeister")
Diese Symphonie liefert in dieser Folge das beste Beispiel für die "Hinwendung" Haydns zu einem leichteren Stil, die im Verlauf der späten 70er Jahre so sehr an Bedeutung gewann. Das Hauptindiz ist darin zu sehen, dass die Symphonie zwei Sätze mit Thema und Variationen, einen langsamen Satz und das Finale umfasst. Vorher traten solche Sätze nur selten in einer Symphonie auf, aber nun verwendet Haydn sie als normale Bauelemente. Diese galante Orientierung bei den einzelnen Sätzen bewirkte darüber hinaus Änderungen in der Gewichtungsstruktur der vier Sätze des Zyklus; dazu näheres im folgenden und in künftigen Folgen.
Der Beiname "Der Schulmeister", den diese Symphonie trägt, ist nicht authentisch; keine der Quellen aus dem 18. Jahrhundert erwähnt ihn, und soweit bekannt ist, bestand kein Zusammenhang mit irgendeiner Haydn-Symphonie, bis der Lexikograph Ernst Ludwig Gerber diesen nach ca. 1820 herstellte. Es stimmt schon, dass Haydn ein Werk mit dem Beinamen "Der Schulmeister" komponiert hat: Ein frühes, nicht erhaltenes Divertimento, Hob. II: 10, trägt diese Bezeichnung in beiden thematischen Katalogen. Möglicherweise entstand der Name im Zusammenhang mit einem Theaterstück für Kinder von Joseph Kurz (Bernadon), der mit Haydn an Der krumme Teufel zusammenarbeitete. Vielleicht war Gerber die Existenz eines solchen Stückes bekannt, und er brachte nur den Namen mit dem falschen Werk in Verbindung.
Der 1. Satz besitzt eine komplexe Struktur. Die Exposition stürmt in einer für Haydn typischen Art voran; ebenso charakteristisch ist die Tatsache, dass es sich beim kontrastierenden, piano gehaltenen "Thema" in Wirklichkeit um eine instabile Konstruktion handelt; die Unmöglichkeit der Kadenzierung wird forte durch die schnelle Unterbrechung bestätigt. Wie bei Nr. 54 fallt auch hier die Durchführung länger aus als die Exposition — sogar viel länger; sie umfasst drei umfangreiche Abschnitte in einem komplexen Modulationssystem. Der zweite beginnt mit einer von Haydns besten "falschen Reprisen". In der "echten" Reprise variieren und erweitern die Bläser die cantabile-Phrase auf wunderbare neue Weise. Der langsame Variationssatz trägt die bemerkenswerte und einzigartige Überschrift "Adagio ma semplicemente". Dass es sich bei der vorgeblichen Schlichtheit Haydns in Wirklichkeit um eine höchst bewusste Exzentrizität handelt, wird deutlich, als die letzte Note der ersten Phrase erklingt, die "zu schnell" im "falschen" harmonischen Kontext auftritt. Beide Teile des Themas weisen "ausgeschriebene" Wiederholungen auf, um den Gegensatz zwischen der anfänglichen "semplice"-Vorstellung — punktiert und staccato — und einer zweiten Vorstellung hervorzuheben, die flexibel, legato und "dolce" ist. Ähnliches gilt auch für die 2. Variation. In den Variationen 1 und 5 wird dieses Prinzip der Gegensätzlichkeit auf andere Weise herausgearbeitet, und zwar durch Dynamik und Orchestrierung, während die pianissimo-Variation 3 als bemerkenswertes Beispiel ausdrucksstarker Chromatik gelten darf.
Das Menuett weist einen lombardischen Rhythmus und (abermals) eine neuartige Rückführung auf; das Trio hat buchstäblich drei Parts (zwei Geigen und Baß). Das Finale besteht wieder aus einer Reihe von Variationen, die auf den ersten Blick an die in der Symphonie Nr. 42 erinnern (vgl. Folge 6); es gibt sogar eine spezielle Bläservariation. Das geistreiche Thema ist nicht weniger reizvoll, wenn auch weniger exzentrisch, als das im langsamen Satz. Hier handelt es sich außerdem ganz klar um ein Beispiel des Haydnschen "Variations-Rondos" (wieder eine der zahlreichen von ihm erfundenen Formen), das sich (ebenfalls) im Finale von Nr. 42 bereits angekündigt hatte. Nach der 2. Variation löst sich die Variationsstruktur auf und wird durch ein modulierendes Zwischenspiel auf der Grundlage krasser Kontraste ersetzt, das wiederum zu einer neuen Variation in Ges, der verminderten Mediante, führt — soweit bekannt ist, stellt dies die erste solche "entlegene" Tonartenbeziehung dar, die je in einem Variationssatz aufgetreten ist. Doch im zweiten Teil werden die Modulationen wieder aufgegriffen, und man kehrt schließlich für eine letzte, mitreißende forte-Variation und ein kurzes, geistreiches Ende wieder zum Grundton zurück.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
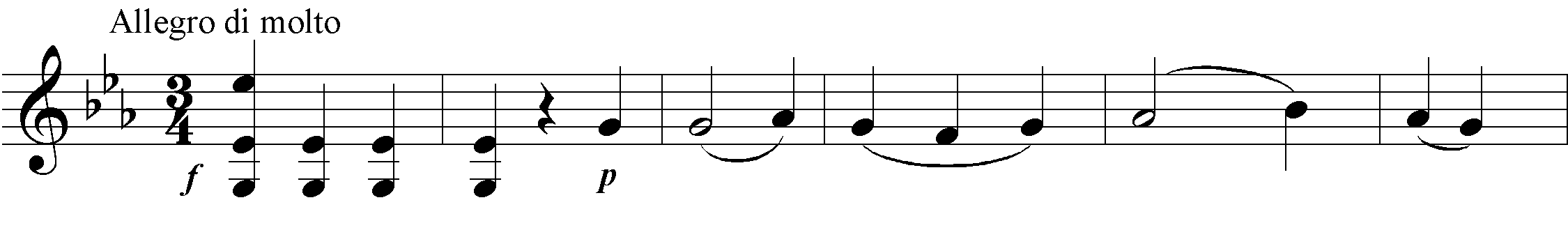
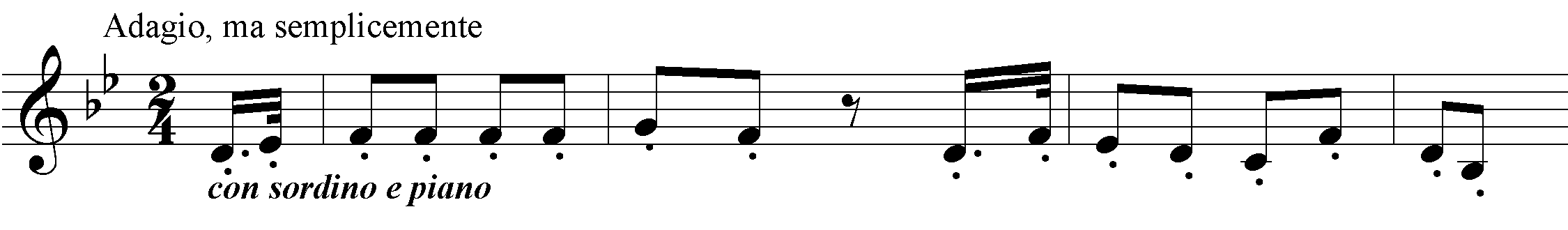
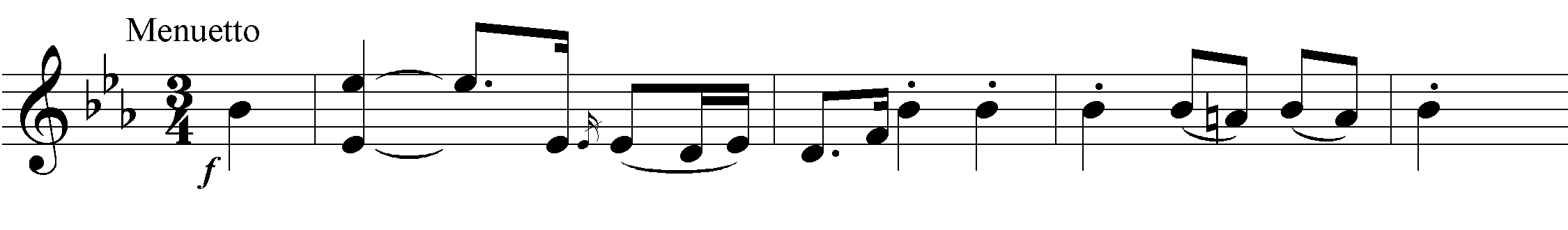
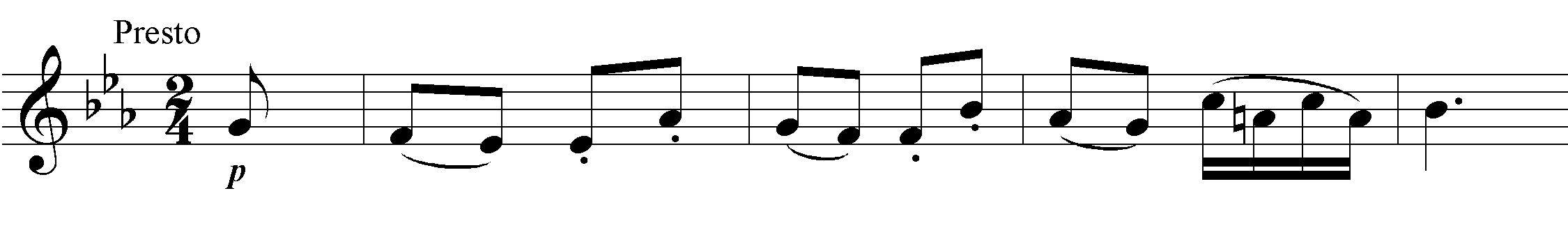
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)