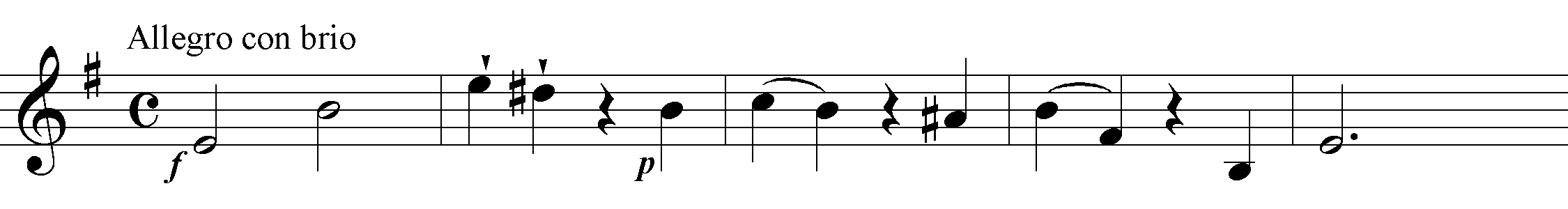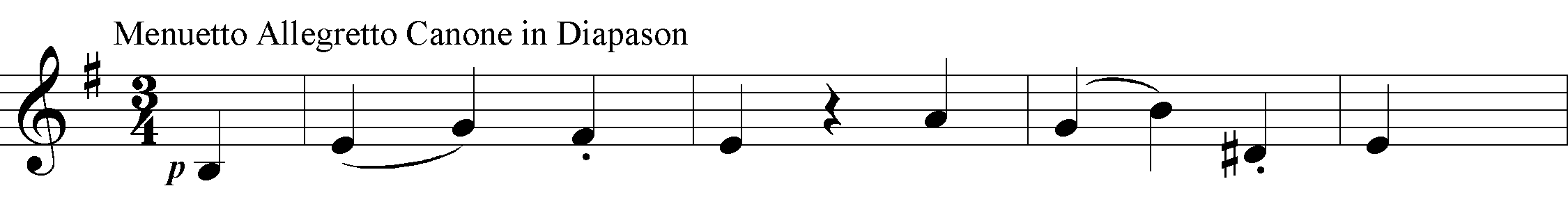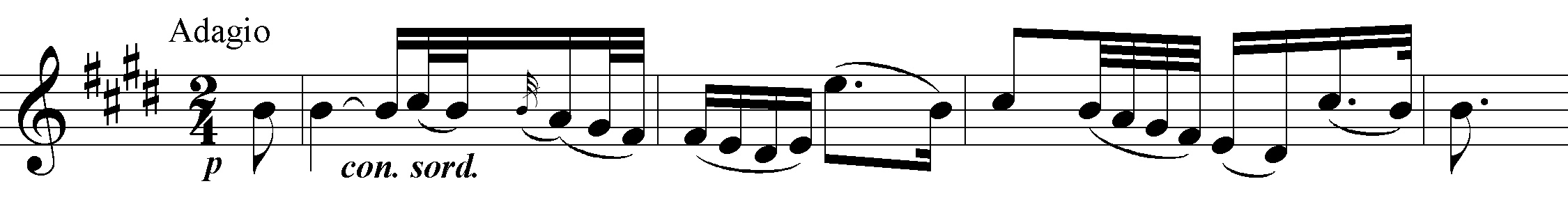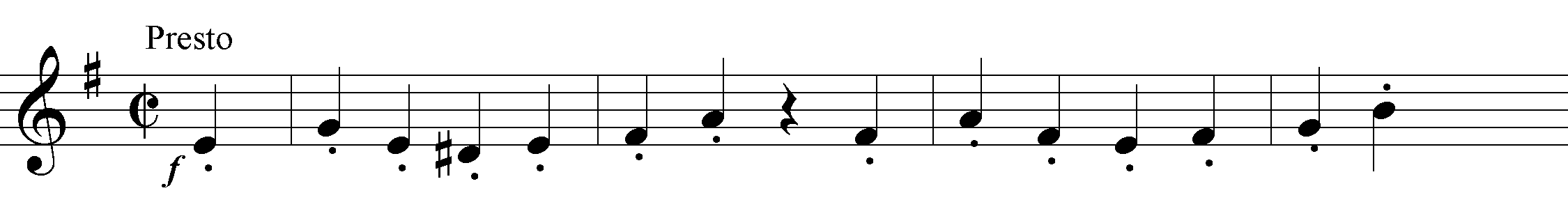44
"Trauersinfonie"
e-Moll
Sinfonien um 1770-1774
Herausgeber: Andreas Friesenhagen und Ulrich Wilker; Reihe I, Band 5b; 2013, G. Henle Verlag München
Hob.I:44 Symphonie in e-Moll
Diese berühmte Symphonie erklärt, warum Haydns Moll-Werke der "Sturm und Drang"-Periode von so hoher Bedeutung sind. Das ganze Werk ist prägnant und konzentriert — nicht eine Note ist zuviel — und es behält seine Stimmung ernsten Leidens mit bemerkenswerter Kontinuität bei. Die einzige Abwechslung von e-Moll ist der Wechsel in die gleichnamige Dur-Tonart, im Trio des Menuetts und im langsamen Satz. In all diesen Aspekten drängt sich der Vergleich mit Beethovens 2. Rasumovsky-Quartett in e-Moll auf.
Die Symphonie ist auch insofern ungewöhnlich, als das Menuett vor dem langsamen Satz steht. Dieses Grundmuster findet man lediglich in fünf weiteren Haydn-Symphonien, die außer einer alle früh entstanden sind. Allerdings begegnet man diesem Modell unverändert in den Streichquartetten op. 9 und op. 17, und in je drei Quartetten von Opus 20 und Opus 33. In jedem Fall zeigt hier die Satzfolge eine Kombination von expressiver Kraft, von Schwung und Gleichgewicht zwischen den Sätzen, die sogar für Haydns Musik außergewöhnlich ist.
Das Allegro con brio ist ein Meisterwerk in Konstruktion und Klangsprache. Das ernste Anfangsmotiv, in Oktaven durch einen Quint- und einen Quartsprung, I-V-VIII, aufsteigend, ist unvergeßlich. Verschiedene unwiderstehliche kontrastierende Phrasen und Begleitfiguren scheinen den ganzen Satz zu dominieren, in einer Art und Weise, die an das berühmte "Quintenquartett", op. 76 Nr. 2 (ebenfalls in Moll) erinnert. Im zweiten Thema erscheint das Motiv mehrmals: am Anfang im Bass, ein paar Takte später dramatisch durch drei Oktaven aufsteigend; und noch später in einer neuen harmonischen Ausrichtung. Gegen Ende des Satzes, nach einer Fermate auf einem verminderten Septimenakkord, kehrt es in einer dreiteiligen Imitation in piano zurück. Dies ruft einen Höhepunkt von unterdrückter Intensität hervor. Der andere wichtige Einfall, eine Sequenzfigur von Sechzehnteln und Achteln, wird als Gegenthema über jenen Eintritt des Basses zu Beginn des zweiten Themas eingeführt.
Die kontrapunktischen Verwicklungen in diesem Satz werden im Menuett ausgeführt. Es ist ein Kanon in der Oktave zwischen Melodie und Bass ("Canone in Diapason"). Die Violinen und die erste Oboe teilen sich die Melodie, während die zweite Oboe und die Violen die Außenstimmen frei in Terzen verdoppeln und die Hörner die Harmonien ausfüllen (oft mit motivischer Bedeutung). Der Kanon ist einfallsreich ausgearbeitet. Besonders effektvoll ist die Passage, die in einem normalen Menuett die Reprise des Hauptthemas wäre: nach einer Fermate wächst der zeitliche Abstand zwischen Melodie- und Bassstimme von einem auf zwei Takte, dies erhöht die unheilkündende, schwermütige Stimmung, die die Askese und Strenge von Anfang an erzeugt haben. Daher ist der Kontrast zum Trio dann so überwältigend, wenn die Violinen aus der Höhe in ein strahlendes E-Dur herabsteigen und die Hörner antworten, indem sie wieder dorthin emporsteigen.
Der gleiche Moll-Dur-Kontrast wird noch in größerem Ausmaß ausgespielt, wenn nach der Wiederholung des Menuetts das Adagio folgt, das wiederum in E-Dur steht. Hier gibt es wenig "Lebhaftigkeit" (außer im Gegenthema zum Eröffnungsthema). Die Stimmung ist feierlich und die Musik durchgehend wundervoll (man beachte in der zweiten Phrase den Dezimensprung aufwärts statt der Oktave). Wenn dann die Oboen und Hörner plötzlich am Ende dieses Gegenthemas einfallen, stehen wir im Banne reiner Schönheit und Empfindung. Wie in sovielen langsamen Sätzen der "Sturm und Drang"-Periode, nimmt Haydn sich Zeit; vielleicht beginnt er z. T. deshalb die Reprise direkt mit diesem zauberhaften Oboen- und Horneinsatz, sogar noch höher als zuvor.
Das Finale, Presto alla breve, übertrifft das Allegro sogar noch an Konzentration und Schwung. Haydn unterbricht zu keinem Zeitpunkt die ruhelose Bewegung dieses Satzes. Ebenso wie das Allegro beginnt er auch hier mit einem Unisono-Thema. Während jedoch die Begleitfiguren akkumulieren, wird der Satz in wachsendem Maße kontrapunktisch, bis das zweite Thema in einen Doppelkanon mündet (die virtuoseste Darbietung kontrapunktischer Kunstfertigkeit in der ganzen Symphonie). Selbst dann, wenn der homophone Satz wiederhergestellt ist, bleibt diese Instabilität bestehen. Noch packender ist die Durchführung; das Kopfmotiv schreitet durch eine aufsteigende neunschrittige Sequenz; von dort moduliert eine neue Variante der Sequenz in fast ebensovielen Schritten abwärts zur Dominante und zur Überleitung. Wie im Adagio geht Haydn direkt zum zweiten Thema (mit dem Doppelkanon) über. Aber in diesem Finale kehrt eine substantielle Coda zum Hauptthema zurück, zuerst nur in bedrohlichen Fragmenten, schließlich jedoch in einer gesteigert kadenzierten Form im Bass. Die unpassende Bezeichnung "TrauerSymphonie" kam im 19. Jahrhundert auf, vielleicht durch eine Aufführung des Adagio in einem Gedenkgottesdienst für Haydn im September 1809 in Berlin ausgelöst. Die überlieferte Bemerkung, dass er sich wünschte, es möge bei seiner Beisetzung gespielt werden, scheint reine Legende zu sein.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
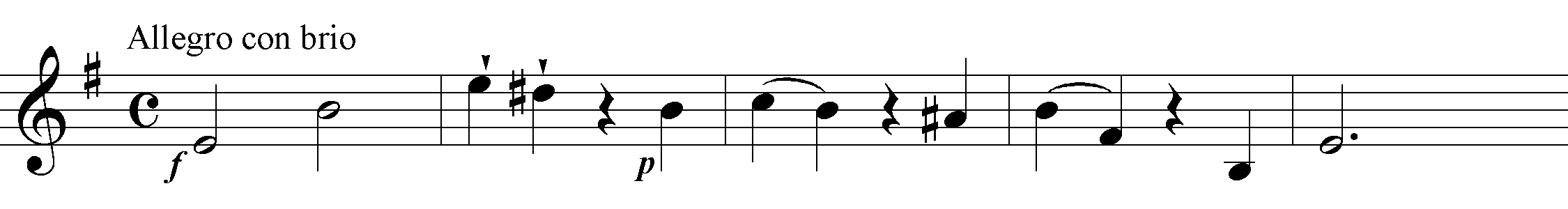
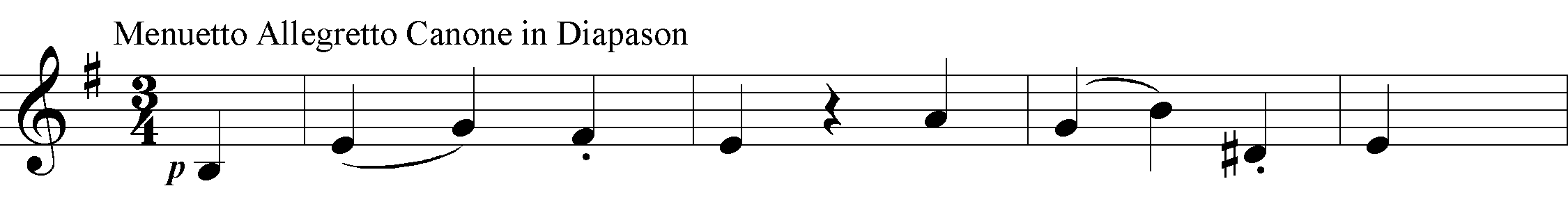
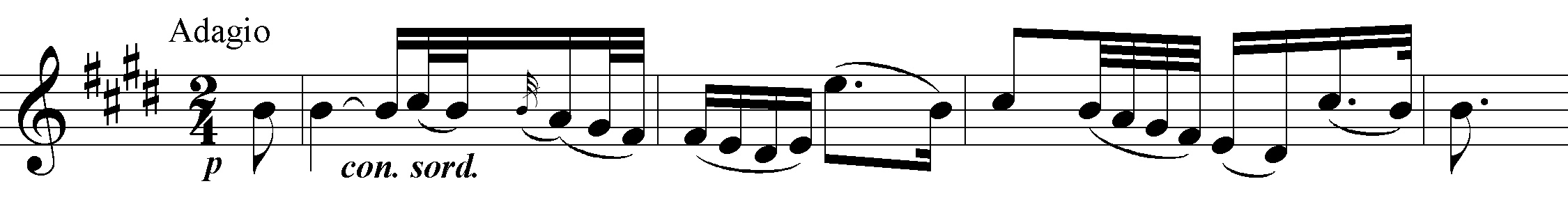
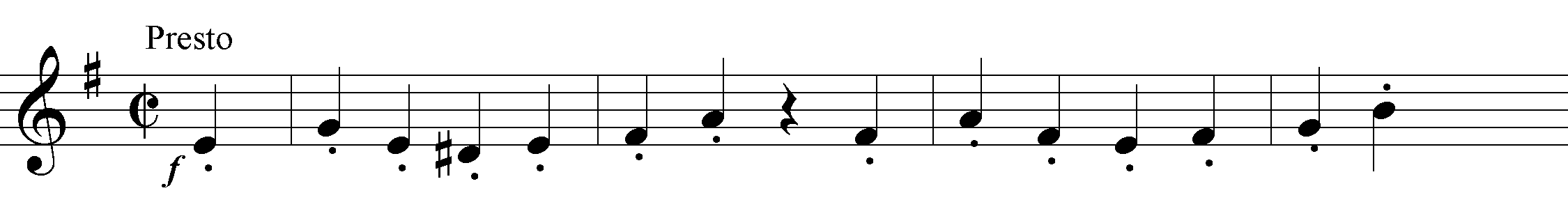
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)