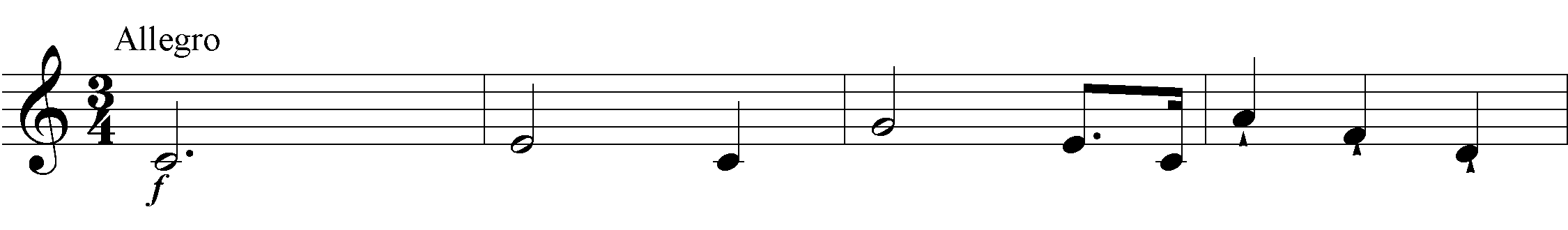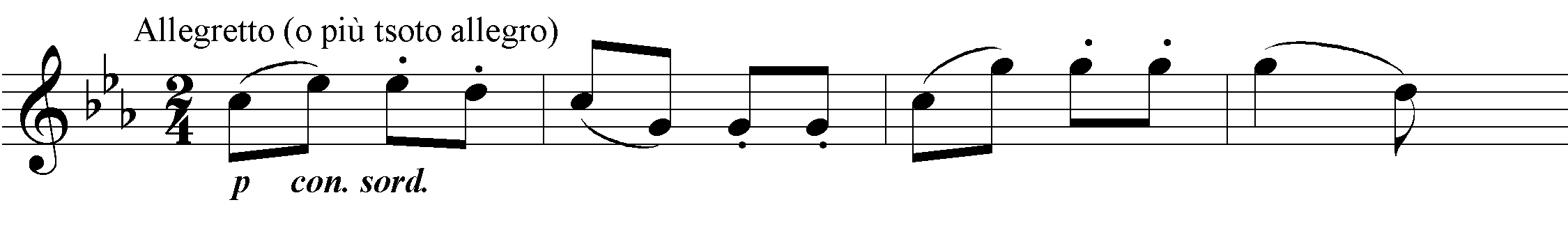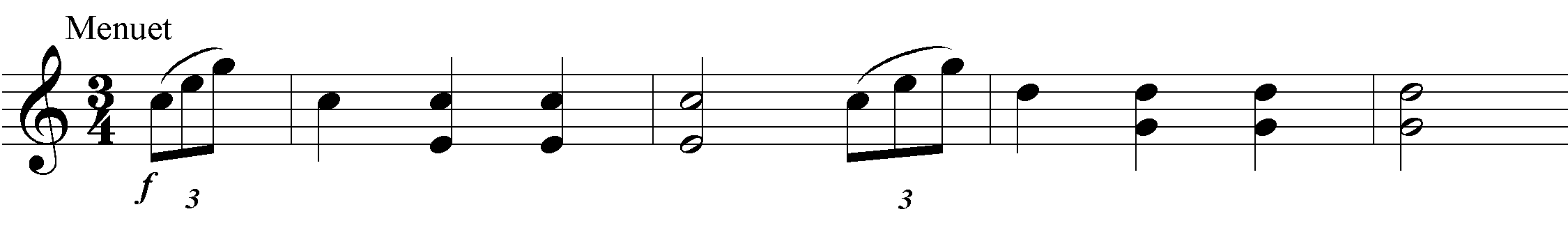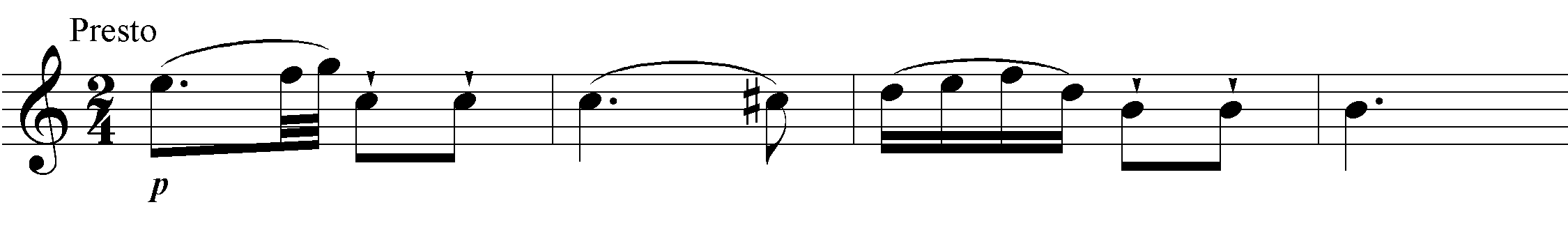63
"La Roxelane"
C-Dur
Sinfonien um 1777-1779
Herausgeber: Sonja Gerlach und Stephen C. Fisher; Reihe I, Band 9; G. Henle Verlag München
Hob.I:63 Symphonie in C-Dur ("La Roxelane")
Von allen Symphonien in dieser Folge veranschaulicht dieses Werk sehr deutlich Haydns Art und Weise der "Unterhaltung" in den späten 1770er Jahren, die "leichtes", interessantes und abwechslungsreiches Vergnügen bietet. Alle Sätze stehen in Dur und sind unmittelbar fasslich sowie durchsichtig strukturiert. Sie bewegen sich innerhalb vertrauter Stile und Konventionen und weisen nur an wenigen Stellen eine expressive Intensität auf. Zu Beginn des ersten Satzes sind zwischen dem ersten Thema und seiner Beantwortung die Kontraste in der Dynamik, der Instrumentation und der satztechnischen Gestaltung kristallklar, so dass die folgenden schnelleren und komplexeren Kontraste ebenso verständlich sind. Die ohne Überleitung einsetzende zweite Gruppe fällt in eine Reihe von blockartigen, wiederum im Inneren kontrastierende Phrasen, die gelegentlich dem ersten Satz der Symphonie Nr. 82 "Der Bär" ähneln, der in derselben Tonart und Taktart steht. Die Durchführung beschränkt sich auf nahe verwandte Tonarten und vermeidet entfernte oder "verwickelte" Modulationen. Andererseits ist sie im Verhältnis zur Exposition ungewöhnlich lang und enthält umfangreiche Wiederholungen von thematischen Blöcken; Haydn gleicht dies durch umfangreiche Kürzungen in der Reprise aus.
Das Allegretto ist ein doppelter Variationssatz (A-B-A1-B1-A2-B2) über eine schwungvolle Melodie, die in den Quellen als "La Roxelane" bezeichnet wird. Wir wissen nicht, ob sie der Bühnenmusik entnommen wurde, die Haydn 1777 für das Theaterstück von Favart komponiert hat oder ob sie von ihm 1779 neu geschrieben wurde. Obwohl der übliche tonartliche Aufbau vertauscht ist — das "Hauptthema" steht in c-Moll, während das kontrastierende Thema in der Durtonart erscheint — setzt sich, wie vorauszusehen war, am Schluss die Durtonart durch. Die letzte Mollvariation verändert ein wenig die Harmonien und den Phrasenrhythmus, während die wiederholten abschließenden Dur-Abschnitte, die vom vollen Orchester gespielt werden, den Schlüssen von kunstvoller ausgearbeiteten Variationssätzen in C-Dur und Zweiertakt in der "Symphonie mit dem Paukenschlag", der "MilitärSymphonie" und der "Symphonie mit dem Paukenwirbel" ähneln.
Das "galante" Menuett mag altmodisch klingen, jedoch ist an Haydns Spiel mit dem "lombardischen" Motiv im Piano, das zum ersten Mal am Ende des Anfangsabschnitts erscheint, nichts "Glattes"; das Trio ist ein Duo für Oboe und Fagott, die durch die Streicher pizzicato begleitet werden. Das Finale in der Sonatenhauptsatzform ist geprägt durch zahlreiche kontrastierende Brüche und Stilmischungen: Ausbrüche in entfernte Klänge, eine harmonisch indirekte Rückführung in die Reprise und sogar eine Art von vierstimmigem Kontrapunkt in der Durchführung. Diese Gegebenheiten könnten nahelegen, dass Haydn gegen seine implizite generelle Ausrichtung auf "reine" Unterhaltung verstieß. Jedoch werden sie eher nur anderen "leicht hörbaren" Passagen hinzugesetzt, als dass sie, wie eine spätere Ästhetik es verlangt haben würde, integraler Bestandteil des Satzes sind.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
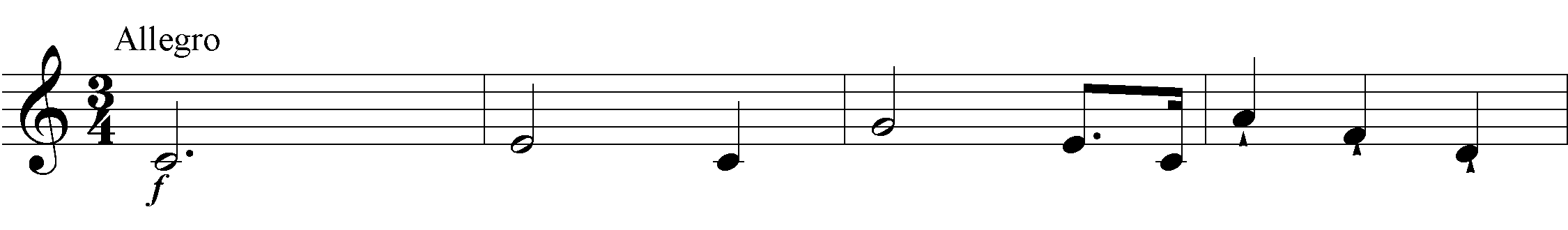
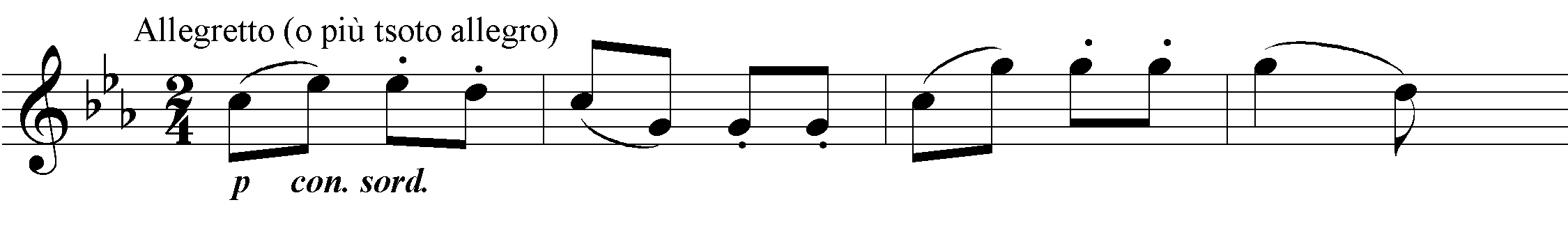
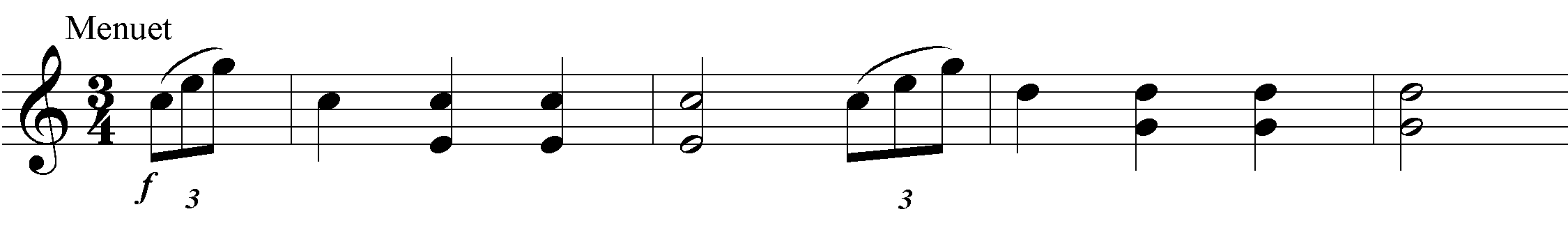
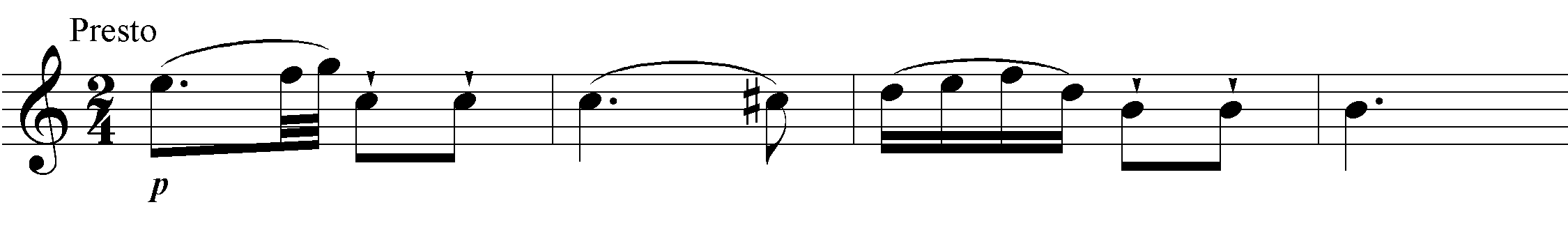
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)