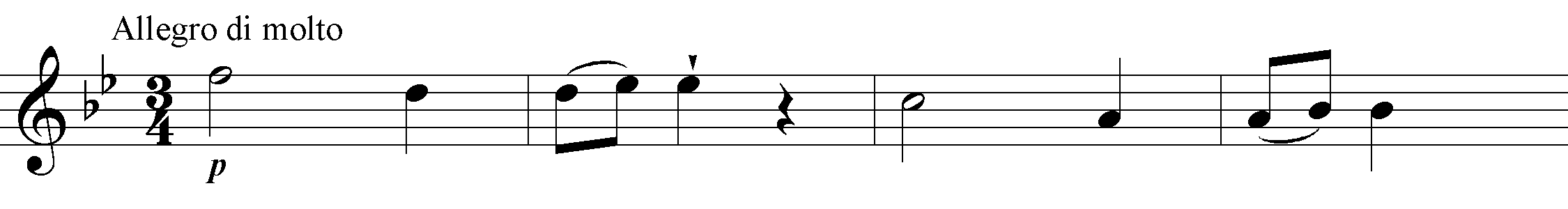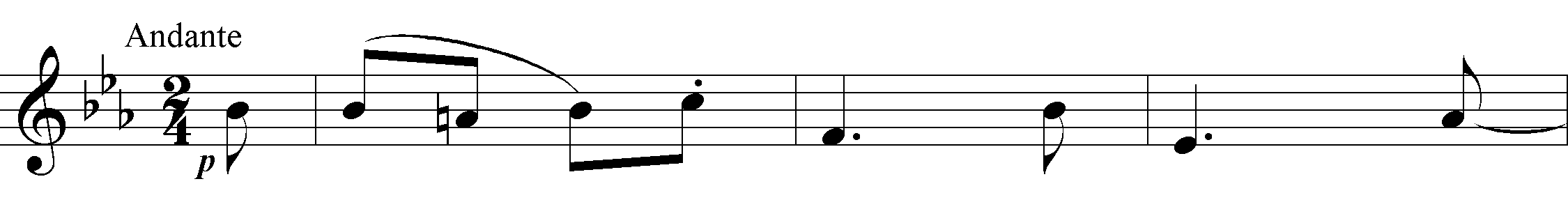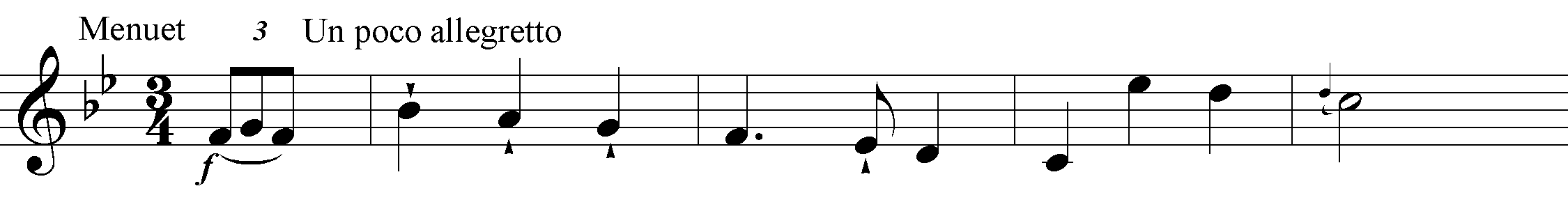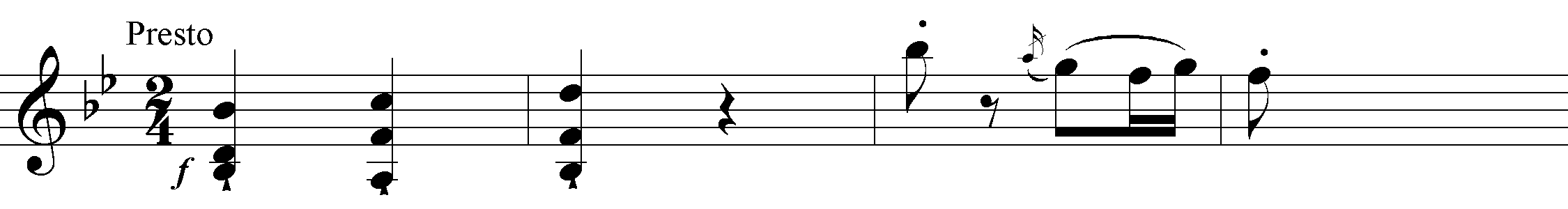35
B-Dur
Sinfonien 1767-1772
Herausgeber: Carl-Gabriel Stellan Mörner; Reihe I, Band 6; G. Henle Verlag München
Joseph Haydn: Unterhaltungssymphonien
In den Jahren 1765-66 ergaben sich folgenschwere Veränderungen in Haydns Stellung und Tätigkeit als Kapellmeister der Fürsten Esterházy. 1761 war er nur zum Vizekapellmeister ernannt worden und zunächst ausschließlich für die fürstliche Hof- und Cammermusique zuständig (was allerdings nicht nur alle Instrumentalmusik einschließlich derer für Orchester umfasste, sondern auch alle weltliche Vokal- und Bühnenmusik). Währenddessen blieb seinem alternden Vorgänger G.J. Werner der Titel des Kapellmeisters erhalten und damit die Verantwortung für die Kirchenmusik. Erst nach Werners Tod im März 1766 wurde Haydn zum Kapellmeister befördert und war damit auch für die Kirchenmusik verantwortlich. Selbstverständlich wandte er sich sogleich mit Eifer der sakralen Vokalmusik zu und komponierte die riesige Missa Cellensis (1766), die (größtenteils verloren gegangene) Missa sunt bona mixta malts im Stile antico und die umfangreiche "Große Orgelmesse" in Es-Dur (beide ca. 1768/69), sowie das Stabat mater (1767, enthusiastisch gelobt von Hasse) und die Kantate "Applausus" (1768), der wir Haydns ausführlichste erhaltene Kommentare zur Aufführungspraxis verdanken. Darüber hinaus kultivierte er, zweifellos auf Veranlassung des Fürsten, die Opera buffa, indem er im gleichen Zeitraum La canterina (1766 uraufgeführt), Lo speziale (1768) und Le pescatrici (1770) komponierte. Und schließlich fanden damals die ersten umfassenden Bauarbeiten am prächtigen neuen Schloss Eszterháza statt; zum Beispiel war das Opernhaus bereits im Herbst 1768 bespielbar (wo wahrscheinlich Haydns Lo speziale die Eröffnungsproduktion war).
Diese unerhörte Aktivität sowohl auf dem Gebiet der sakralen Vokalmusik als auch auf dem der komischen Oper bildet den Hintergrund für Haydns sinfonisches Schaffen während der zweiten Hälfte der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts. Dass zwischen der Erhabenheit der Sakralmusik und seinem sogenannten "Sturm-und-Drang"-Stil (siehe Bände 6-7) ein Zusammenhang bestand, ist seit langem erwiesen. Im Gegensatz zur traditionellen Ansicht war jedoch der "theatralische" Stil für Haydns sinfonische Musik dieser Periode ebenso bedeutsam. In jüngster Zeit ist auf die Möglichkeit hingewiesen worden, dass nicht nur viele Symphonien dieser Zeit ganz oder teilweise aus Schauspiel- oder Bühnenmusik hervorgegangen sein könnten (was 1774-81 mit Sicherheit der Fall war), sondern dass der "Sturm und Drang" vielleicht, selbst in seinen ausdrucksvollsten Aspekten, nur eine Intensivierung von Haydns Interesse an der Theatermusik darstellte. Obwohl dies Spekulation bleibt, steht die Bedeutung der "Unterhaltung" als maßgebliches Konzept für seine Symphonien dieser Periode außer Frage - wie die vorliegenden Werke zur Genüge beweisen.
©James Webster
Hob.I:35 Symphonie in B-Dur
Obwohl diese Ende 1767 entstandene Symphonie nach äußerlichen Kriterien ganz und gar nicht außergewöhnlich ist - sie bedient sich einer verbreiteten Durtonart, der üblichen Sequenz von vier Sätzen und der Standardbesetzung aus zwei Oboen, zwei Hörnern und Streichern (die Bläser schweigen im langsamen Satz und im Trio), sie hat weder einen Beinamen noch programmatische oder dramatische Bezüge und weist keine offenkundigen Verstöße gegen Konventionen der Form oder stilistische Schicklichkeit auf—, verkörpert sie durchweg die hohe Kunst, derer Haydn fähig war, wenn es ihm darum ging, "Unterhaltungsmusik" zu schaffen. Das Allegro di molto beruht ausschließlich auf zwei kontrastierenden Ideen, die zu Beginn vorgestellt werden: einem anmutigen Cantabile-Motiv der Streicher (unterbrochen durch eine von den Hörnern angeführte Fanfare) und einem kraftvollen Unisonothema nach einem "galoppierenden" Motiv. Die sangliche Idee taucht in vielen verschiedenen Zusammenhängen auf; wie gewohnt variiert Haydn sie jedes Mal (man beachte vor allem die ausgefallenen Fortsätze in der zweiten Themengruppe und zu Beginn der Reprise die verblüffende neue Form des Horneinschubs). Die Durchführung, ein Modellfall ihres Typs, besteht aus zwei Teilen, die nacheinander die beiden Themen aufbrechen und analysieren.
Das Andante in Sonatenform zeigt die muntere Tiefgründigkeit mit exzentrischen Anklängen, wie sie für Haydns langsame Sätze typisch ist, wenn diese nicht als Adagio angelegt sind. Es beginnt mit einem köstlichen Beispiel tonaler Gewitztheit: Obwohl es in der Subdominanten Tonart Es-Dur steht, beginnt die fünf Takte lange einleitende Phrase so, dass B-Dur impliziert wird (das im Ohr nachklingt), mit unvorhergesehenen Konsequenzen bei jedem nachfolgenden Auftreten — nicht zuletzt ganz am Schluss, wo endlich das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. (Dies ist vermutlich das erste umfängliche Beispiel dafür, was bei Haydn bald zum altbekannten Scherz werden sollte: die Idee, einen Satz mit seiner einleitenden Phrase zu beenden.) Das dynamische Menuett ist ein Meisterstück an Raffiniertheit, mit unerwarteten Wechseln der Tonlage und Phrasierungen (am deutlichsten in Verbindung mit dem getrillten Motif, das erstmals im 2. Takt auftaucht); am wenigsten erwartet wird der überraschend einfache piano Schluss. Das Presto-Finale wiederholt den Kunstgriff Anfang = Ende; der Scherz kommt umso besser an, als die drei einleitenden "Hammerschläge" von der Tonika zur Mediante emporsteigen. Darum endet der Satz melodisch "abseits" der Tonika; dieser Bruch mit der Konvention ist besonders nachhaltig, weil wir die Schläge in dieser Funktion bereits am Ende der Exposition gehört haben — allerdings als bloßen konventionellen "Nachschlag" und ganz der Tonika verhaftet.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
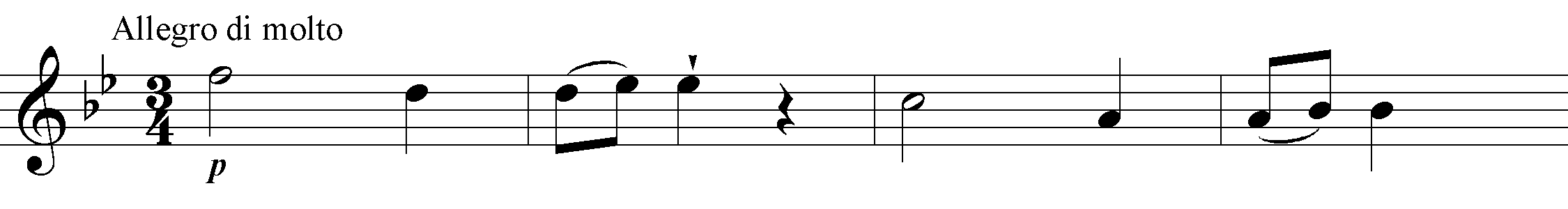
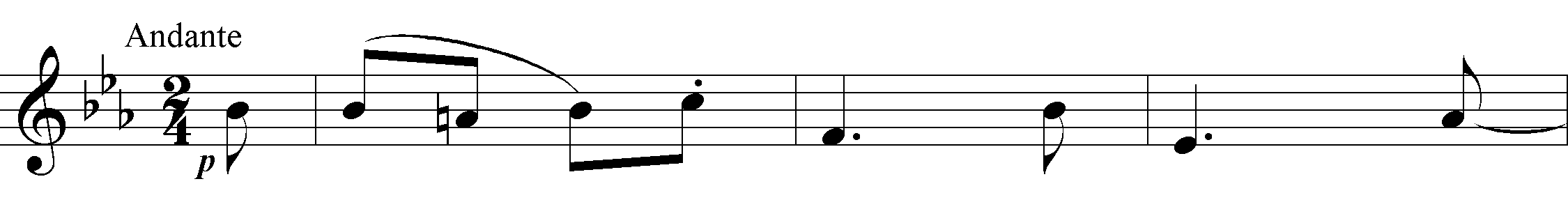
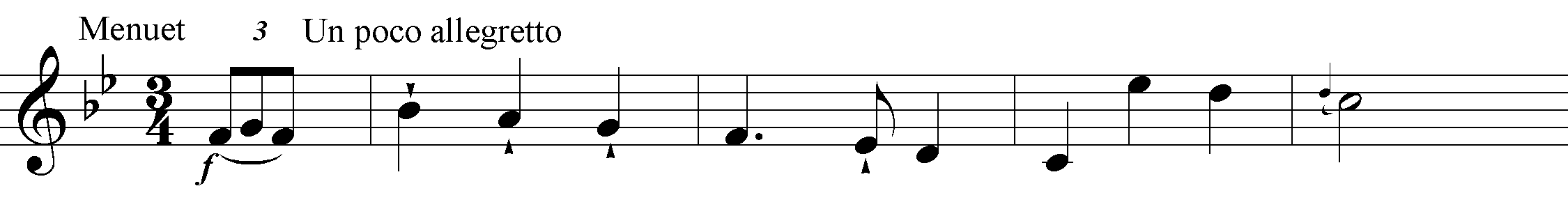
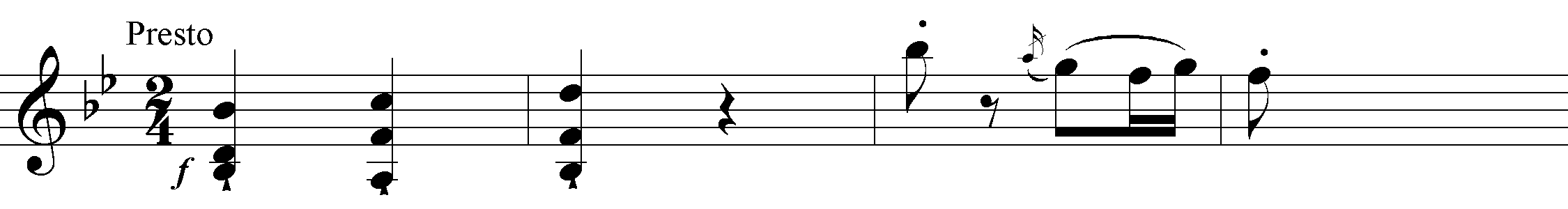
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)