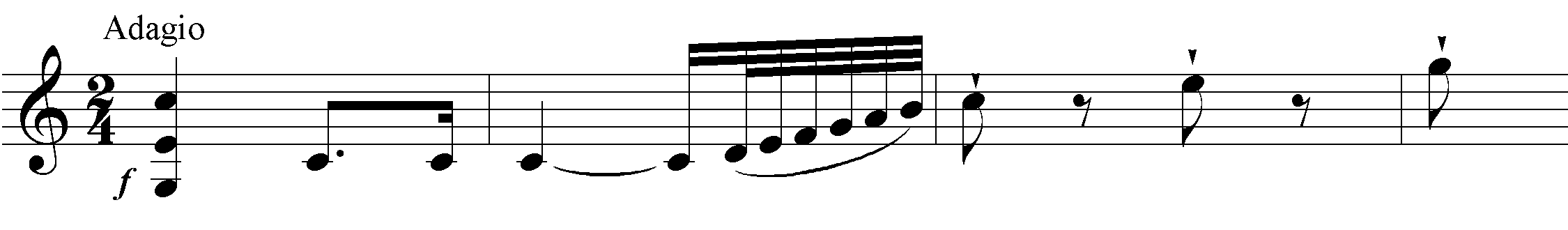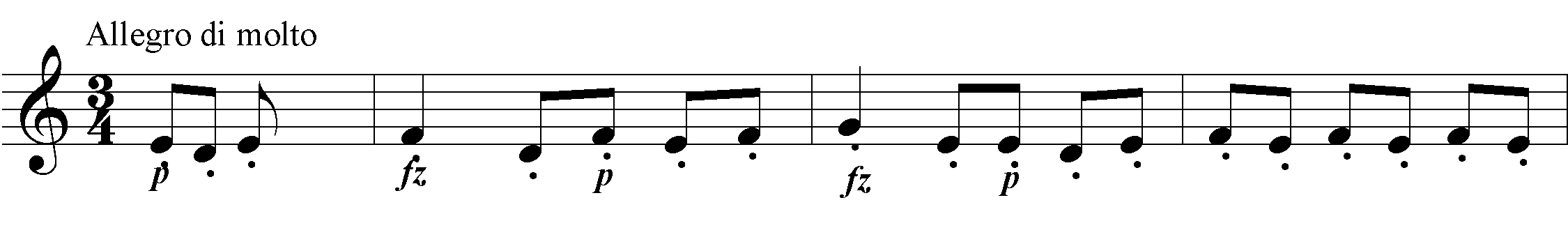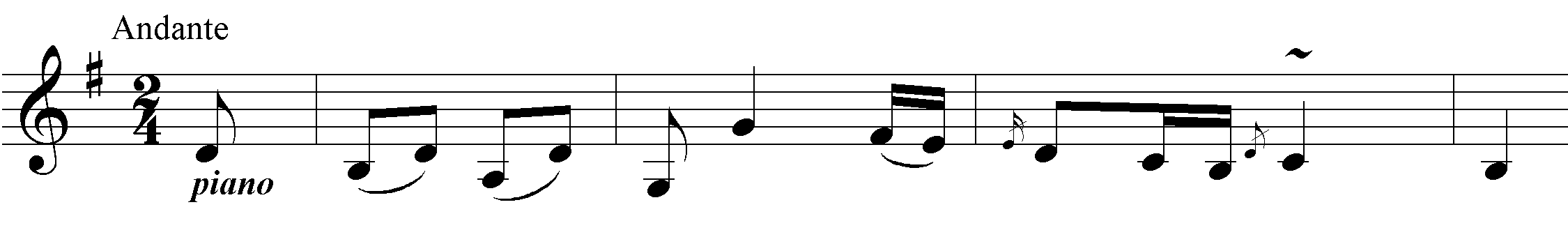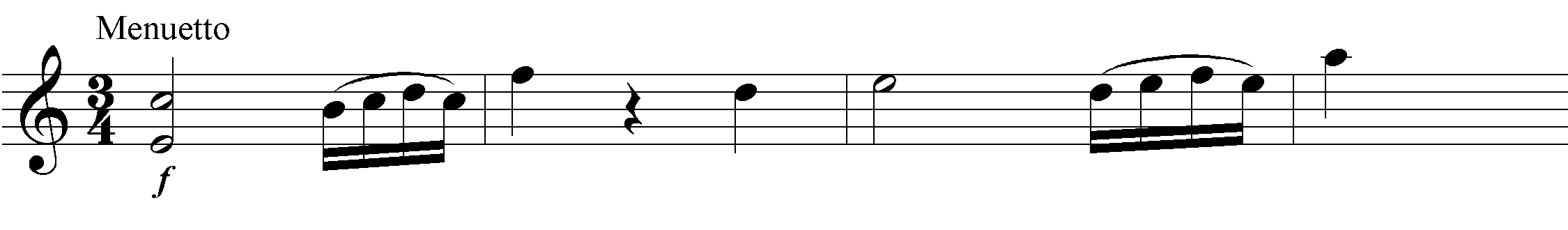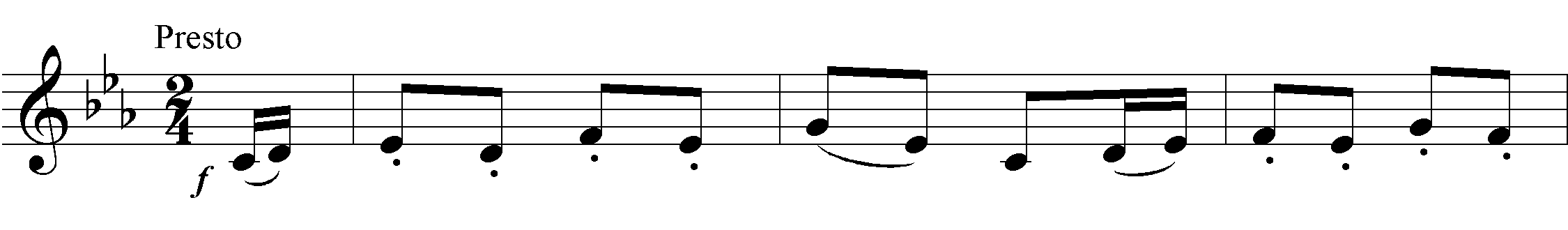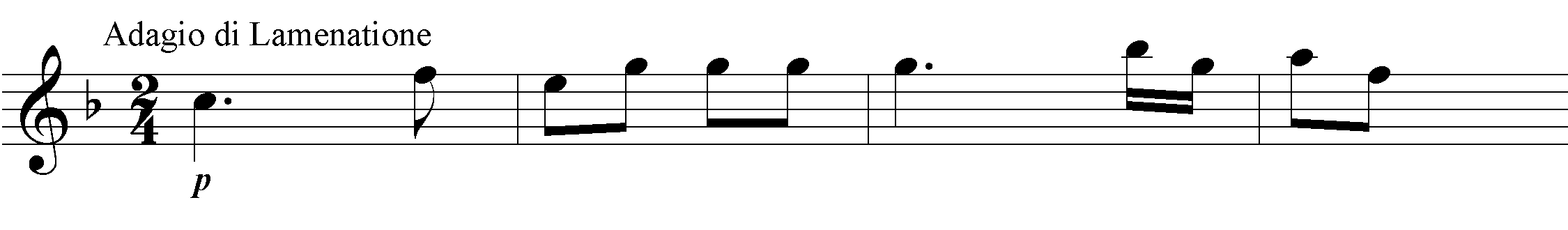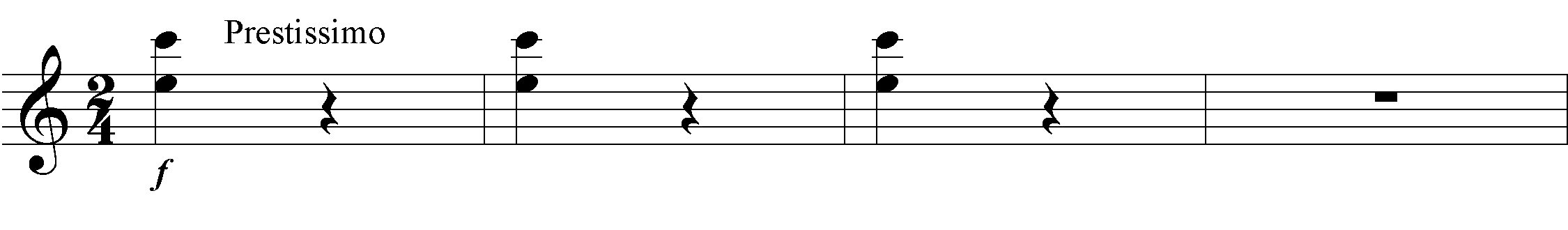60
"Il distratto"
C-Dur
Sinfonien um 1770-1774
Herausgeber: Andreas Friesenhagen und Ulrich Wilker; Reihe I, Band 5b; 2013, G. Henle Verlag München
Hob.I:60 Symphonie in C-Dur ("Il distratto")
Dieses Werk entstand ursprünglich als Begleitmusik für eine Komödie in fünf Akten, in der es um den im Titel erwähnten "geistesabwesenden" Léandre geht. Zwar gibt es Hypothesen, die das Gegenteil behaupten, aber diese Symphonie ist die einzige von Haydn, bei der sich dokumentieren lässt, dass sie ursprünglich als Musik für die Bühne komponiert wurde. Dieser einmalige Status spiegelt sich sowohl in den stilistischen Eigenheiten als auch in der Tatsache wider, dass es sich um eine Symphonie mit sechs Sätzen handelt — eine generische Anomalie, die in der österreichischen Musik des 18. Jahrhunderts nur bei unverhohlen programmatischen Werken auftritt. Der erste Satz diente als Ouvertüre, die Sätze zwei bis fünf als Zwischenaktmusik, und der letzte als eine Art "Finale" nach Ende des Theaterstücks.
Haydns Musik traf dank ihrer Veranschaulichung des Dramas auf weit verbreitete und begeisterte Resonanz. Im gegenwärtigen Kontext muss ein knapper Hinweis auf seine großartige Bearbeitung genügen. Ich zitiere Auszüge aus der Synopse von Robert A. Green.
Die meisten Charaktere [ ...] haben mit der Commedia dell'arte zu tun und waren für Haydn und das zeitgenössische Publikum als Typen sofort erfaßbar. Clarice und Isabelle sind zwei wohlerzogene junge Damen. Der Chevalier, der Bruder von Clarice, ist der typische adlige Soldat, der zecht, Jagd auf Frauen macht und in den Künsten des Galans wohl bewandert ist. Mme. Grognac ist die autoritäre Mutter auf der Suche nach einem reichen Mann für Isabelle, ohne Rücksicht auf die Wünsche ihrer Tochter. Der Geiz von Mme. Grognac wird gründlich ausgenutzt [...] Lisette und Carlin sind die Diener, die ihre Stärken einsetzen, um die Schwächen ihrer Herrschaften auszugleichen [...] Léandre, le distrait, ist ein Charaktertyp, der durch die folgende, 1688 in Jean de La Bruyères Les Caractères veröffentlichte Beschreibung geläufig war [...]
[Er] kommt die Treppe herunter, öffnet die Tür, um hinauszugehen, und schließt sie dann wieder; er bemerkt, dass er seine Schlafmütze trägt; und beim genaueren Hinsehen entdeckt er, dass er sich nur halb rasiert hat [...] Bei einer anderen Gelegenheit besucht er eine Dame, und nachdem er bald zu der Überzeugung gelangt, er selbst sei der Gastgeber, lässt er sich gemütlich im Sessel nieder und macht keinerlei Anstalten, wieder aufzustehen [...] Eines morgens heiratet er und hat es am selben Abend schon wieder vergessen [...] Der erste Satz (Ouvertüre) ähnelt dem der Symphonie Nr. 50, was Tonart, Taktmaß, das Vorhandensein einer langsamen Einleitung u.v.a. betrifft. Der eine deutlich illustrative Passus tritt in der zweiten Gruppe der Exposition auf: Nachdem sie bei einer lokalen Subdominante angekommen ist, verharrt die Musik nicht weniger als zwölf Takte lang darauf und verklingt melodisch (sie ist auf einer einzigen Note hängengeblieben), dynamisch ("perdendosi") und rhythmisch: Sie ist buchstäblich "steckengeblieben". Verblüffender ist, kurz nach Beginn des Durchführungsteils, der Einbruch der ersten Takte der "Abschiedssymphonie": Stellt Haydn selbst sich hier geistesabwesend? Im darauf folgenden Andante werden die kontrastierenden Themen so interpretiert, als stellten sie die Bühnenfiguren selbst dar: Zuerst die friedfertige Isabelle, dann die strenge Mme. Grognac; danach könnte im Durchführungsteil eine "französische" Tanzparodie als Hinweis auf den zügellosen Chevalier gedeutet werden, dem Isabelle leichtfertig ihr Herz geschenkt hat; und so weiter. Es fallt alles so leicht, und man sollte nicht vergessen, dass die meisten dieser Bezüge nur Spekulation sind, sogar die, die auf die (ebenfalls spekulativen) zeitgenössischen Rezensionen der 1770er Jahre zurückgehen. Die Hörer werden ermuntert, selbst Bezüge herzustellen. Man kann freilich der Versuchung nicht widerstehen, den dummen Scherz im Finale damit zu erklären, dass Léandre sich einen Knoten ins Taschentuch macht, um ja seine Hochzeitsnacht nicht zu vergessen. Das "Sich Besinnen" wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Musik nach wenigen Takten plötzlich abbricht, während die Geigen ihre tiefste Saite, die sie in einem Anfall von "Geistesabwesenheit" auf F gelassen hatten, auf G umstimmen.
©James Webster
Analyse

Analyse der Sätze
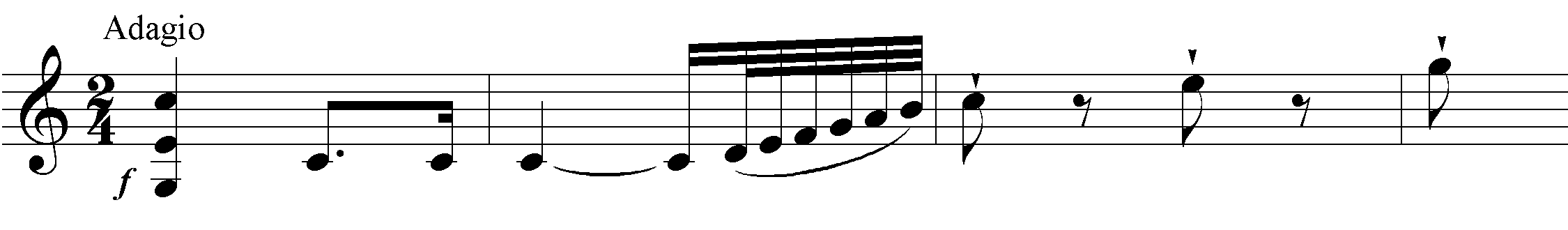
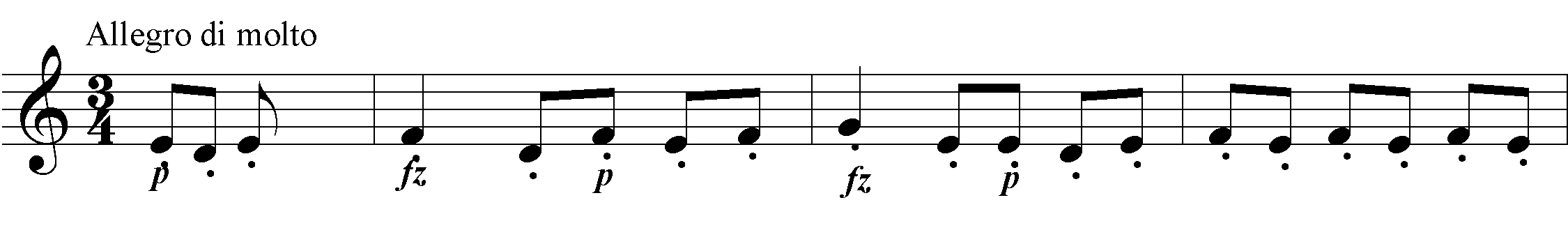
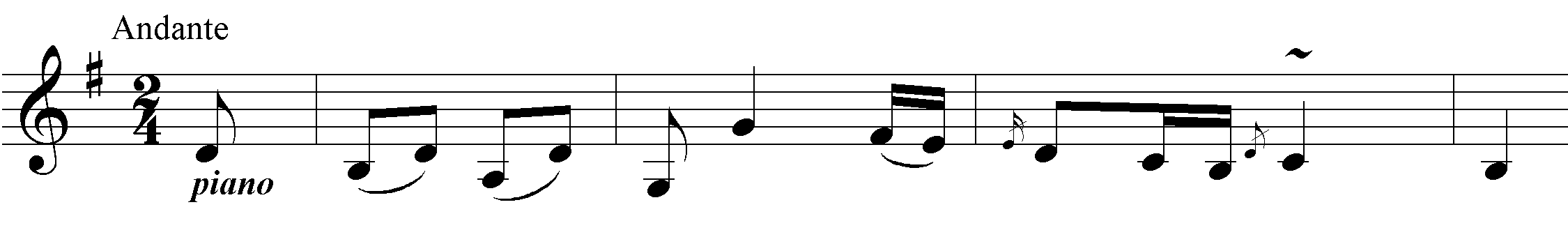
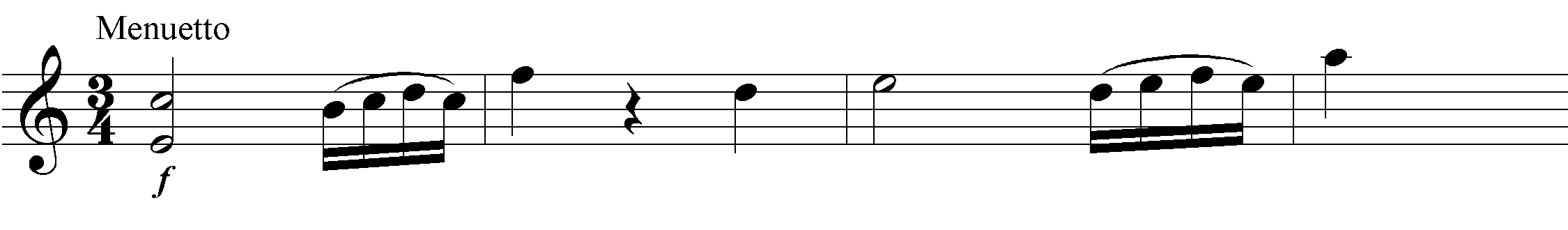
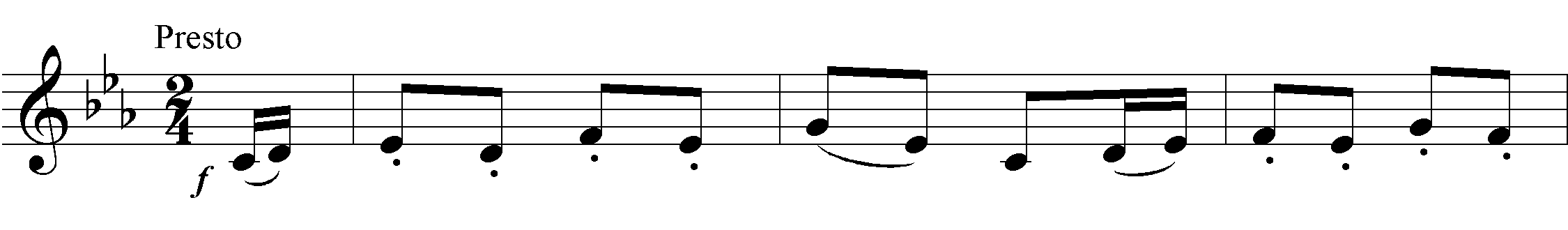
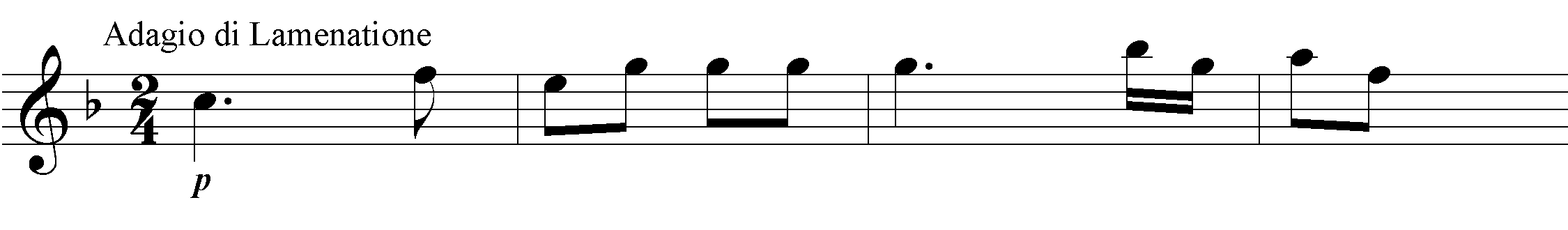
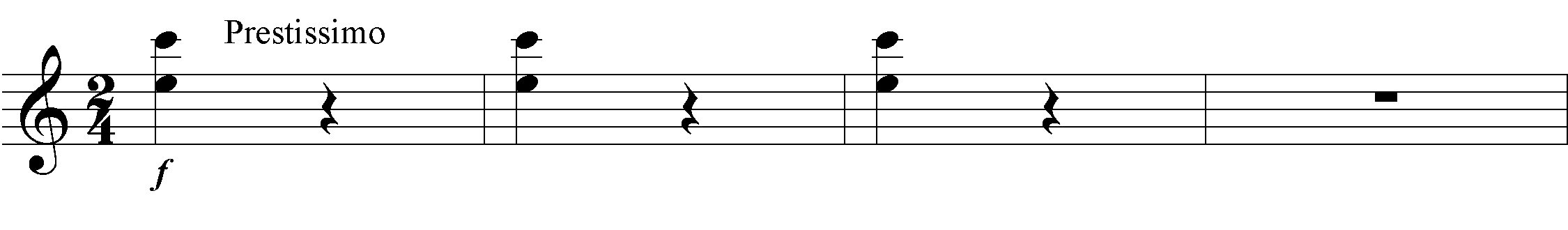
Musiker

Musiker
Anders als etwa bei den Opern lassen sich bei den Sinfonien, auf Grund ihrer unklaren zeitlichen Zuordnung, vollständige Besetzungs- bzw. Namenslisten der Orchestermusiker nicht anführen. Und es ist überhaupt nur bei einer der drei „Sinfonie-Schaffens-Phasen“ möglich, nämlich der mittleren Phase, jener am Hofe der Esterházys (1761-1781 letzte Sinfonie für das Esterház-Publikum) respektive 1790). Bei der ersten Phase, im Dienste des Grafen Morzin, also vor Esterházy (1757-1761) und der dritten Phase, jener danach (1782-1795) ist es überhaupt nicht möglich. Im Übrigen lässt sich die dritte Phase wiederum in drei Abschnitte gliedern: Jenen, in dem Haydn erstmals für ein „anderes“ Publikum als seines am Hofe Esterház komponierte (1782-1784), den Pariser Sinfonien (1785-1786) und den Londoner Sinfonien bis (1791-1795).
Namens- bzw. Gehaltslisten – und aus jenen wurde die Orchesterbesetzung „extrahiert“ - existieren also nur aus der Schaffensphase im Dienst der beiden Fürsten Esterházy, also von 1761 bis 1782.
Daher werden „nur“ jene Musiker angeführt, die im Dienste der beiden Fürsten Esterházy standen und mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum in Haydns Orchester wirkten, quasi ein „All-Time – All-Stars-Orchester“. Ich behielt bei den betreffenden Musikern die Jahreszahl „-1790“ bei, da mit Sicherheit Haydn auch nach 1782 seine Sinfonien am Hofe zu Gehör brachte.
| Flöte | Franz Sigl 1761-1773 |
| Flöte | Zacharias Hirsch 1777-1790 |
| Oboe | Michael Kapfer 1761-1769 |
| Oboe | Georg Kapfer 1761-1770 |
| Oboe | Anton Mayer 1782-1790 |
| Oboe | Joseph Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Johann Hinterberger 1761-1777 |
| Fagott | Franz Czerwenka 1784-1790 |
| Fagott | Joseph Steiner 1781-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Franz Pauer 1770-1790 |
| Horn (spielte Violine) | Joseph Oliva 1770-1790 |
| Pauke oder Fagott | Caspar Peczival 1773-1790 |
| Violine | Luigi Tomasini 1761-1790 |
| Violine (Stimmführer 2. Vl) | Johann Tost 1783-1788 |
| Violine | Joseph Purgsteiner 1766-1790 |
| Violine | Joseph Dietzl 1766-1790 |
| Violine | Vito Ungricht 1777-1790 |
| Violine (meist Viola) | Christian Specht 1777-1790 |
| Violoncello | Anton Kraft 1779-1790 |
| Violone | Carl Schieringer 1768-1790 |
Medien

Musik
Antal Dorati
Joseph Haydn
The Symphonies
Philharmonia Hungarica
33 CDs, aufgenommen 1970 bis 1974, herausgegeben 1996 Decca (Universal)